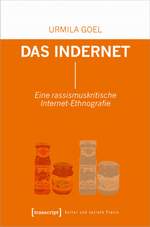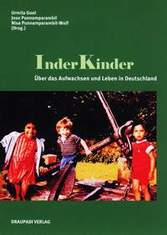... newer stories
Donnerstag, 29. November 2012
Berlin leistet sich was
urmila, 16:52h
Berlin mag arm sein, leistet es sich aber ordentlich in die Festung Europa zu investieren. Laut taz berlin :
"11 Millionen Euro kostet der Abschiebeknast das Land Berlin pro Jahr. [...] Den Löwenanteil verschlingen dabei die Personalkosten für die 181 Bediensteten mit 9,4 Millionen Euro. Die Miete beträgt 1,5 Millionen Euro."
Und das bei derzeit 13 Abschiebehäfltingen (im Oktober war zeitweise nur einer drinnen). Das soll nochmal jemand sagen, die Ausländer nehmen Arbeitsplätze weg. Ganz eindeutig schaffen sie welche.
Abschiebehaft ist nicht nur menschenunwürdig, sie ist auch eine Geldverschwendung.
"11 Millionen Euro kostet der Abschiebeknast das Land Berlin pro Jahr. [...] Den Löwenanteil verschlingen dabei die Personalkosten für die 181 Bediensteten mit 9,4 Millionen Euro. Die Miete beträgt 1,5 Millionen Euro."
Und das bei derzeit 13 Abschiebehäfltingen (im Oktober war zeitweise nur einer drinnen). Das soll nochmal jemand sagen, die Ausländer nehmen Arbeitsplätze weg. Ganz eindeutig schaffen sie welche.
Abschiebehaft ist nicht nur menschenunwürdig, sie ist auch eine Geldverschwendung.
0 Kommentare in: abschieben ... comment ... link
Äpfel und Birnen
urmila, 16:43h
In einem taz-Artikel über die Abwesenheit von biodeutschen Kindern in Klassen mit Kindern mit dem sogenannten Migrationshintergrund werden Äpfel mit Birnen verglichen:
"Doch Mittelschichtseltern sind enorm findig, wenn es darum geht, ihren Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen. [...] Eltern mit Migrationshintergrund wissen oft gar nicht, dass ihnen diese Möglichkeit offensteht."
taz-Autor Daniel Bax stellt hier den Mittelschichtseltern den Eltern mit Migrationshintergrund gegenüber. Als ob es keine Mittelschichtseltern mit Migrationshintergrund gebe. Damit bildet Bax die Debatte wahrscheinlich gut ab.
"Doch Mittelschichtseltern sind enorm findig, wenn es darum geht, ihren Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen. [...] Eltern mit Migrationshintergrund wissen oft gar nicht, dass ihnen diese Möglichkeit offensteht."
taz-Autor Daniel Bax stellt hier den Mittelschichtseltern den Eltern mit Migrationshintergrund gegenüber. Als ob es keine Mittelschichtseltern mit Migrationshintergrund gebe. Damit bildet Bax die Debatte wahrscheinlich gut ab.
0 Kommentare in: interdependenz ... comment ... link
Mittwoch, 28. November 2012
Mädchenmordendes Indien
urmila, 17:38h
Im Februar war ich Gast auf einer feministischen Konferenz in Indien und schrieb auf dem Blog suedasien.info unter anderem:
"Im Panel über pränatale (und präzeugungs) Diagnostik (mit Mary John, Anita Ghai, Rennu Khanna und Farah Nagvi) wurde die Verquickung von Kampagnen gegen die Abtreibung weiblicher Föten zum einen mit Anti-Abtreibungs-Kampagnen sowie zum anderen mit eugenischem Aussortieren von unwertem Leben herausgearbeitet. Es wurde kritisiert, dass viele Interventionen gegen die Abtreibung weiblicher Föten letztendlich heteronormativitätsstabilisierend wirken. Für feministische Politiken wurde gefordert, dass nicht an den Syptomen (den Abtreibungen) zu arbeiten sei, sondern die grundlegende Abwertung von Frauen thematisiert und bekämpft werden müsse."
Die Abtreibung weiblicher Föten ist ein gesellschaftspolitisches Thema in Indien, es gibt staatliche Massnahmen dagegen (so ist zum Beispiel die pränatale Geschlechtsbestimmung verboten), es gibt Engagement dagegen und trotzdem gibt es die Praxis weiter. Es ist also ein wichtiges Thema.
So wie Georg Blume das Thema heute in der taz aufgreift, kommt die Diskussion allerdings nicht weiter. Es ist mal wieder einer von Blumes komplexitätsreduzierenden exotisierenden Indienartikeln, die im wesentlichen belegen, wie furchtbar Indien ist. Indem aktuellen Artikel "Eine Frau wehrt sich" tut Blume so, als ob die von ihm porträtierte Mitu Khurana die einzige Inderin wäre, die sich gegen die Abtreibung weiblicher Föten engagiere. Nun könnte es sein, dass Blume es nicht besser weiss (was bedenklich wäre, denn von einem seriösen Journalisten würde ich Recherche erwarten).
Aber dem ist nicht so, im März dieses Jahres hat Blume schon einen Artikel mit der gleichen Protagonistin in der Zeit veröffentlicht und da immerhin auf das gesetzliche Verbot der pränatalen Geschlechtsbestimmung, auf eine Rede des Ministerpräsidenten und weiteres Engagement gegen die Praxis hingewiesen (auch der Artikel ist allerdings pauschalisierend und abwertend). Blume weiss es also besser, was es noch fraglicher macht, warum er im taz so tut als ob Khurana und er die Einzigen wären, die das Thema öffentlich machen.
Befremdlich ist auch, dass die Print-taz auf der Titelseite mit der Schlagzeile "Die Abtreibungsgegnerin" auf den Artikel hinweist. Das schliesst an das Panel bei der feministischen Konferenz an. Der Kampf gegen ein patriarchales System wird missbraucht, um das Recht auf Abtreibung in Frage zu stellen.
"Im Panel über pränatale (und präzeugungs) Diagnostik (mit Mary John, Anita Ghai, Rennu Khanna und Farah Nagvi) wurde die Verquickung von Kampagnen gegen die Abtreibung weiblicher Föten zum einen mit Anti-Abtreibungs-Kampagnen sowie zum anderen mit eugenischem Aussortieren von unwertem Leben herausgearbeitet. Es wurde kritisiert, dass viele Interventionen gegen die Abtreibung weiblicher Föten letztendlich heteronormativitätsstabilisierend wirken. Für feministische Politiken wurde gefordert, dass nicht an den Syptomen (den Abtreibungen) zu arbeiten sei, sondern die grundlegende Abwertung von Frauen thematisiert und bekämpft werden müsse."
Die Abtreibung weiblicher Föten ist ein gesellschaftspolitisches Thema in Indien, es gibt staatliche Massnahmen dagegen (so ist zum Beispiel die pränatale Geschlechtsbestimmung verboten), es gibt Engagement dagegen und trotzdem gibt es die Praxis weiter. Es ist also ein wichtiges Thema.
So wie Georg Blume das Thema heute in der taz aufgreift, kommt die Diskussion allerdings nicht weiter. Es ist mal wieder einer von Blumes komplexitätsreduzierenden exotisierenden Indienartikeln, die im wesentlichen belegen, wie furchtbar Indien ist. Indem aktuellen Artikel "Eine Frau wehrt sich" tut Blume so, als ob die von ihm porträtierte Mitu Khurana die einzige Inderin wäre, die sich gegen die Abtreibung weiblicher Föten engagiere. Nun könnte es sein, dass Blume es nicht besser weiss (was bedenklich wäre, denn von einem seriösen Journalisten würde ich Recherche erwarten).
Aber dem ist nicht so, im März dieses Jahres hat Blume schon einen Artikel mit der gleichen Protagonistin in der Zeit veröffentlicht und da immerhin auf das gesetzliche Verbot der pränatalen Geschlechtsbestimmung, auf eine Rede des Ministerpräsidenten und weiteres Engagement gegen die Praxis hingewiesen (auch der Artikel ist allerdings pauschalisierend und abwertend). Blume weiss es also besser, was es noch fraglicher macht, warum er im taz so tut als ob Khurana und er die Einzigen wären, die das Thema öffentlich machen.
Befremdlich ist auch, dass die Print-taz auf der Titelseite mit der Schlagzeile "Die Abtreibungsgegnerin" auf den Artikel hinweist. Das schliesst an das Panel bei der feministischen Konferenz an. Der Kampf gegen ein patriarchales System wird missbraucht, um das Recht auf Abtreibung in Frage zu stellen.
0 Kommentare in: interdependenz ... comment ... link
Problematische Vergleiche
urmila, 17:14h
Die taz berichtet über den prekären Status von Nachwuchswissenschaftler_innen in Deutschland. Ein wichtiges Thema - an den Unis läuft es richtig schief. Trotzdem sollte mensch vorsichtig sein, wie sie das Problem definiert. Die taz zitiert eine Doktorandin wie folgt:
" "Unmöglich, an die Promotion zu denken, wenn man so viel verdient wie KassiererInnen an der Supermarktkasse"
Was soll das heissen? Wieso kann mensch da nicht an die Promotion denken? Wenn die Kassierer_innen davon leben können, dann müssten es Doktorand_innen auch können (vorallem weil sie Aufstiegschancen haben, die Kassierer_innen nicht haben). Oder aber auch Kassierer_innen können davon nicht leben.
Was will die Doktorandin sagen? Dass ihr Gehalt zu gering ist und sie noch andere Jobs braucht, um über die Runden zu kommen? Dann sollte sie sich mit den Kassierer_innen verbünden. Oder dass die kurzfristigen Verträge ihr keine Planungsperspektive geben? Dann braucht es den Verweis auf Kassierer_innen nicht. Oder dass Forschung nicht ausreichend finanziell gewürdigt wird? Dann lässt sich natürlich klassistisch auf die Kassierer_innen runterschauen.
" "Unmöglich, an die Promotion zu denken, wenn man so viel verdient wie KassiererInnen an der Supermarktkasse"
Was soll das heissen? Wieso kann mensch da nicht an die Promotion denken? Wenn die Kassierer_innen davon leben können, dann müssten es Doktorand_innen auch können (vorallem weil sie Aufstiegschancen haben, die Kassierer_innen nicht haben). Oder aber auch Kassierer_innen können davon nicht leben.
Was will die Doktorandin sagen? Dass ihr Gehalt zu gering ist und sie noch andere Jobs braucht, um über die Runden zu kommen? Dann sollte sie sich mit den Kassierer_innen verbünden. Oder dass die kurzfristigen Verträge ihr keine Planungsperspektive geben? Dann braucht es den Verweis auf Kassierer_innen nicht. Oder dass Forschung nicht ausreichend finanziell gewürdigt wird? Dann lässt sich natürlich klassistisch auf die Kassierer_innen runterschauen.
0 Kommentare in: klasse ... comment ... link
Samstag, 24. November 2012
Mehr Frauen?
urmila, 20:09h
Das DIW betitelt eine Pressemitteilung mit "Auto-Mobilität: Mehr Frauen und ältere Menschen am Steuer". In der taz ist dazu zu lesen:
"Frauen - über alle Altersgruppen gesehen - nennen häufiger ein privates Kraftfahrzeug ihr Eigen und nutzen es auch öfter als vor zehn Jahren, während Männer diesbezüglich bescheidener geworden sind."
Irgendwie bekomme ich beim Lesen das Gefühl, dass Frauen jetzt besonders häufig hinter dem Lenkrad sitzen. Dass sie im Gegensatz zu Männern nicht umweltbewusster werden und häufiger andere Verkehrsmittel wählen. Die Frauen als Umweltsäue.
Sowohl der taz-Artikel wie die DIW-Pressemitteilung zeigen aber mal wieder die Schwierigkeiten der Interpretation von statistischen Daten. In der Pressemitteilung steht:
"Frauen spielen eine immer wichtigere Rolle im Pkw-Verkehr: Auf 1 000 Frauen kommen heute 400 Autos, vor zehn Jahren waren es rund 280 Autos. 1 000 Männer teilen sich rechnerisch etwa 715 Fahrzeuge."
Die Überschrift dazu könnte auch lauten: "Fast doppelt so viele Männer haben Autos". Denn 715 von 1000 Männer haben ein Auto, aber nur 400 von 1000 Frauen. Wieviele Autos 1000 Männer vor zehn Jahren hatten, teilt die Pressemitteilung nicht mit. Auf dieser Grundlage kann ich also nicht feststellen, wie sich das Verhältnis von Frauen-Autos zu Männer-Autos verändert hat. Ist es gleich geblieben? Hat sich der Abstand verringert oder vergrößert? Wenn diese Information vorliegen würde, liesse sich etwas über die Veränderung des Gender-Unterschieds aussagen.
Auf Basis der vorliegenden Statistik liesse sich auch titeln: "Frauen weiterhin viel umweltbewusster als Männer - sie verweigern sich der Angleichung im Autobesitz" oder "Frauen scheinen weiterhin über weniger ökonomische Ressourcen zu verfügen" oder ....
Anhand der explizit angebenen Statistiken lässt sich schön sehen, wer als normal angesehen wird und deswegen nicht besonders betrachtet werden muss: der mittelalte Mann. Über den erfahren wir nur indirekt etwas, dadurch das die Jungen, die Alten und die Frauen in Bezug zu ihm gesetzt werden.
Dass Männer bescheidener geworden sind, kann ich aus den Daten hingegen nicht ersehen.
"Frauen - über alle Altersgruppen gesehen - nennen häufiger ein privates Kraftfahrzeug ihr Eigen und nutzen es auch öfter als vor zehn Jahren, während Männer diesbezüglich bescheidener geworden sind."
Irgendwie bekomme ich beim Lesen das Gefühl, dass Frauen jetzt besonders häufig hinter dem Lenkrad sitzen. Dass sie im Gegensatz zu Männern nicht umweltbewusster werden und häufiger andere Verkehrsmittel wählen. Die Frauen als Umweltsäue.
Sowohl der taz-Artikel wie die DIW-Pressemitteilung zeigen aber mal wieder die Schwierigkeiten der Interpretation von statistischen Daten. In der Pressemitteilung steht:
"Frauen spielen eine immer wichtigere Rolle im Pkw-Verkehr: Auf 1 000 Frauen kommen heute 400 Autos, vor zehn Jahren waren es rund 280 Autos. 1 000 Männer teilen sich rechnerisch etwa 715 Fahrzeuge."
Die Überschrift dazu könnte auch lauten: "Fast doppelt so viele Männer haben Autos". Denn 715 von 1000 Männer haben ein Auto, aber nur 400 von 1000 Frauen. Wieviele Autos 1000 Männer vor zehn Jahren hatten, teilt die Pressemitteilung nicht mit. Auf dieser Grundlage kann ich also nicht feststellen, wie sich das Verhältnis von Frauen-Autos zu Männer-Autos verändert hat. Ist es gleich geblieben? Hat sich der Abstand verringert oder vergrößert? Wenn diese Information vorliegen würde, liesse sich etwas über die Veränderung des Gender-Unterschieds aussagen.
Auf Basis der vorliegenden Statistik liesse sich auch titeln: "Frauen weiterhin viel umweltbewusster als Männer - sie verweigern sich der Angleichung im Autobesitz" oder "Frauen scheinen weiterhin über weniger ökonomische Ressourcen zu verfügen" oder ....
Anhand der explizit angebenen Statistiken lässt sich schön sehen, wer als normal angesehen wird und deswegen nicht besonders betrachtet werden muss: der mittelalte Mann. Über den erfahren wir nur indirekt etwas, dadurch das die Jungen, die Alten und die Frauen in Bezug zu ihm gesetzt werden.
Dass Männer bescheidener geworden sind, kann ich aus den Daten hingegen nicht ersehen.
0 Kommentare in: statistik ... comment ... link
Freitag, 23. November 2012
20 Jahre Mölln
urmila, 21:08h
Die taz berichtet über die Bedeutung des Brandanschlags in Mölln für Menschen, die befürchten mussten, dass auch sie Ziel von Angriffen werden könnten.
"Einer, dem die Anschläge von Mölln bis ins Mark gingen, war der Schriftsteller Feridun Zaimoglu. Er lebte schon damals in Kiel, im gleichen Bundesland wie die Kleinstadt Mölln. „Es war eine schwarze Zeit“, sagt er. „Viele Leute haben sich damals gefragt: ist es jetzt besser die Koffer zu packen? Das hat die Menschen geprägt, die haben das bis heute nicht vergessen.“ "
Auch in meinen Interviews mit InderKindern konnte ich Ende der 1990er Jahre feststellen, wie bedeutend Mölln, Sollingen, Rostock waren. Diese Anschläge haben vielen vor Augen geführt, dass sie nicht als selbstverständlich zugehörig anerkannt werden, haben ihnen gezeigt, dass sie - egal wie sie sich fühlen - als Andere angesehen werden.
"Einer, dem die Anschläge von Mölln bis ins Mark gingen, war der Schriftsteller Feridun Zaimoglu. Er lebte schon damals in Kiel, im gleichen Bundesland wie die Kleinstadt Mölln. „Es war eine schwarze Zeit“, sagt er. „Viele Leute haben sich damals gefragt: ist es jetzt besser die Koffer zu packen? Das hat die Menschen geprägt, die haben das bis heute nicht vergessen.“ "
Auch in meinen Interviews mit InderKindern konnte ich Ende der 1990er Jahre feststellen, wie bedeutend Mölln, Sollingen, Rostock waren. Diese Anschläge haben vielen vor Augen geführt, dass sie nicht als selbstverständlich zugehörig anerkannt werden, haben ihnen gezeigt, dass sie - egal wie sie sich fühlen - als Andere angesehen werden.
0 Kommentare in: andere deutsche ... comment ... link
Donnerstag, 22. November 2012
Die Protestierenden und die Politiker_innen
urmila, 23:56h
Heute war das Treffen der Protestierenden am Brandenburger Tor und Bundestagspolitiker_innen (siehe z.B. rbb-online). Die Forderungen der Protestierenden waren laut dem Blog des Refugee Strikes folgende:
"1. Anerkennung aller Asylsuchenden als politisch Geflüchtete
2. Stopp aller Abschiebungen
3. Aufhebung der Residenzpflicht
4. Nicht Prüfung und Aufrechterhaltung der Lager sondern Wohnungen"
Das sind sehr konkrete Forderungen, auch wenn sie umfassend und radikal sind. Das Treffen war laut rbb-online aber "ergebnislos". Aus Sicht der sogenannten Integrationsbeauftragten, weil:
"Das Treffen sei für eine politische Demonstration genutzt worden, sagte die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Maria Böhmer (CDU), im Anschluss an das Gespräch am Donnerstagabend. Damit sei die Chance, über konkrete Probleme zu reden, vertan worden."
Warum wird eigentlich Menschen in prekären Situationen vorgeworfen, dass sie politisch handeln? Warum sollten sie das nicht tun, wenn sie mit Politiker_innen zusammentreffen? War von den Protestierenden erwartet worden, dass sie sich mit Almosen abspeisen lassen?
"Es sei schwierig gewesen, sich auszutauschen, weil die Forderungen sehr allgemein und die Fronten verhärtet gewesen seien, so der Flüchtlingsexperte der Grünen, Josef Winkler. "
Die Forderungen war sehr konkret und umfassend, es geht um existentielle Rechte der Protestierenden, da ist es doch kein Wunder, dass sie darauf beharren. Was hatten die Politiker_innen den erwartet? Wurden den Protestierenden denn irgendwas angeboten?
Nachtrag 24.11.12: Die taz berichtet ausführlicher über das Treffen und zeigt, wie wenig es der CDU um eine Auseinandersetzung mit den politischen Forderungen der Protestierenden geht.
"Selbst am nächsten Morgen war Reinhard Grindel noch aufgeregt: Ein „Skandal“ sei das Treffen mit der Flüchtlingsdelegation am Vorabend gewesen, sagt der CDU-Obmann im Innenausschuss des Bundestags, eine „Zumutung“. Statt über „ihre persönliche Lage zu sprechen“, hätten die „nur politische Erklärungen“ abgegeben und „Rassismus-Vorwürfe erhoben“. Das Gespräch sei „nicht geeignet gewesen, zu irgendeiner Art von politischer Konsequenz zu kommen“, so Grindel. "
Die Protestierenden verstehen sehr klar, dass die Politiker_innen mit ihnen nicht auf Augenhöhe verhandeln wollen, dass sie sich der politischen Auseinandersetzung verweigern und die gesellschaftlichen Verhältnisse unzulässig individualisieren:
" „Man hat von uns erwartet, dass wir dankbar sind“, sagte die Iranerin Mansureh Komeigani. „Aber hier leben Menschen zehn Jahre im Lager, das belastet sie psychisch sehr. Warum sollen wir dafür dankbar sein?“
Sie kritisierte, dass die Abgeordneten nicht akzeptiert hätten, dass die Flüchtlinge eine politische Erklärung abgeben wollten. „Wir sollten nur über uns selber sprechen. Aber wir waren eine Delegation für alle Flüchtlinge. Deswegen mussten wir auch über die Gesetze sprechen, die für unsere Lebensverhältnisse verantwortlich sind.“ "
Zudem verwehren sie sich dagegen kriminalisiert zu werden und das Verhältnisse verharmlost werden sollen:
"„So werden wir als Kriminelle hingestellt, die kontrolliert werden müssen“, sagte Komeigani. „Die Abgeordneten wollten sogar, dass wir nicht das Wort ’Lager‘ benutzen. Aber es ist wie ein Gefängnis ohne Mauern.“ "
Wenn sich die Politiker_innen so gar nicht auf eine politische Auseinandersetzung einlassen wollten, warum haben sie dann das Gespräch angeboten? Haben sie wirklich gedacht, die Protestierenden, die höchst politisch agieren, würden sich mit dem Individualisieren ihrer Anliegen zufrieden stellen lassen und sich Paternalismus aussetzen.
Nachtrag 25.11.12: Die Bundestagsabgeordnete Halina Wawzyniak berichtet über das Treffen auf ihrem Blog.
Nachtrag 26.11.12: Weitere selbstbewusste Asylbewerbende in Freudenstadt. Die taz berichtet.
"1. Anerkennung aller Asylsuchenden als politisch Geflüchtete
2. Stopp aller Abschiebungen
3. Aufhebung der Residenzpflicht
4. Nicht Prüfung und Aufrechterhaltung der Lager sondern Wohnungen"
Das sind sehr konkrete Forderungen, auch wenn sie umfassend und radikal sind. Das Treffen war laut rbb-online aber "ergebnislos". Aus Sicht der sogenannten Integrationsbeauftragten, weil:
"Das Treffen sei für eine politische Demonstration genutzt worden, sagte die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Maria Böhmer (CDU), im Anschluss an das Gespräch am Donnerstagabend. Damit sei die Chance, über konkrete Probleme zu reden, vertan worden."
Warum wird eigentlich Menschen in prekären Situationen vorgeworfen, dass sie politisch handeln? Warum sollten sie das nicht tun, wenn sie mit Politiker_innen zusammentreffen? War von den Protestierenden erwartet worden, dass sie sich mit Almosen abspeisen lassen?
"Es sei schwierig gewesen, sich auszutauschen, weil die Forderungen sehr allgemein und die Fronten verhärtet gewesen seien, so der Flüchtlingsexperte der Grünen, Josef Winkler. "
Die Forderungen war sehr konkret und umfassend, es geht um existentielle Rechte der Protestierenden, da ist es doch kein Wunder, dass sie darauf beharren. Was hatten die Politiker_innen den erwartet? Wurden den Protestierenden denn irgendwas angeboten?
Nachtrag 24.11.12: Die taz berichtet ausführlicher über das Treffen und zeigt, wie wenig es der CDU um eine Auseinandersetzung mit den politischen Forderungen der Protestierenden geht.
"Selbst am nächsten Morgen war Reinhard Grindel noch aufgeregt: Ein „Skandal“ sei das Treffen mit der Flüchtlingsdelegation am Vorabend gewesen, sagt der CDU-Obmann im Innenausschuss des Bundestags, eine „Zumutung“. Statt über „ihre persönliche Lage zu sprechen“, hätten die „nur politische Erklärungen“ abgegeben und „Rassismus-Vorwürfe erhoben“. Das Gespräch sei „nicht geeignet gewesen, zu irgendeiner Art von politischer Konsequenz zu kommen“, so Grindel. "
Die Protestierenden verstehen sehr klar, dass die Politiker_innen mit ihnen nicht auf Augenhöhe verhandeln wollen, dass sie sich der politischen Auseinandersetzung verweigern und die gesellschaftlichen Verhältnisse unzulässig individualisieren:
" „Man hat von uns erwartet, dass wir dankbar sind“, sagte die Iranerin Mansureh Komeigani. „Aber hier leben Menschen zehn Jahre im Lager, das belastet sie psychisch sehr. Warum sollen wir dafür dankbar sein?“
Sie kritisierte, dass die Abgeordneten nicht akzeptiert hätten, dass die Flüchtlinge eine politische Erklärung abgeben wollten. „Wir sollten nur über uns selber sprechen. Aber wir waren eine Delegation für alle Flüchtlinge. Deswegen mussten wir auch über die Gesetze sprechen, die für unsere Lebensverhältnisse verantwortlich sind.“ "
Zudem verwehren sie sich dagegen kriminalisiert zu werden und das Verhältnisse verharmlost werden sollen:
"„So werden wir als Kriminelle hingestellt, die kontrolliert werden müssen“, sagte Komeigani. „Die Abgeordneten wollten sogar, dass wir nicht das Wort ’Lager‘ benutzen. Aber es ist wie ein Gefängnis ohne Mauern.“ "
Wenn sich die Politiker_innen so gar nicht auf eine politische Auseinandersetzung einlassen wollten, warum haben sie dann das Gespräch angeboten? Haben sie wirklich gedacht, die Protestierenden, die höchst politisch agieren, würden sich mit dem Individualisieren ihrer Anliegen zufrieden stellen lassen und sich Paternalismus aussetzen.
Nachtrag 25.11.12: Die Bundestagsabgeordnete Halina Wawzyniak berichtet über das Treffen auf ihrem Blog.
Nachtrag 26.11.12: Weitere selbstbewusste Asylbewerbende in Freudenstadt. Die taz berichtet.
0 Kommentare in: asylprotest ... comment ... link
Pink money
urmila, 17:25h
In der taz interviewen Jan Feddersen und Martin Reichert die USamerikanische Historikerin Dagmar Herzog zu aktuellen Entwicklungen in den USA und dazu, ob Obamas Wahlsieg einen "Triumph für die sexuellen Bürgerrechte" bedeutet. Herzog beschreibt, wie es dazu kam, dass sich Obama für LGBT-Rechte einsetzt:
"Auf die Dauer hilft nur Power. Obama war sich ja auch lange unsicher, ob er bei dem Thema einsteigen soll. Aber dann wurde Druck auf ihn ausgeübt, und zwar von seinen finanziellen Unterstützern. „Pink Money“, zwei seiner wichtigsten Geldgeber für den Wahlkampf waren Schwule, und die haben dann gesagt: Jetzt mach mal, Obama, sonst bekommst du kein Geld. Das war der heilsame Druck. "
Heilsam hört sich das für mich gar nicht an, wenn politische Haltung durch Geld erkauft wird. Das heisst, dass nur die, die über genügend finanzielle Ressourcen verfügen, Unterstützung bekommen.
"Auf die Dauer hilft nur Power. Obama war sich ja auch lange unsicher, ob er bei dem Thema einsteigen soll. Aber dann wurde Druck auf ihn ausgeübt, und zwar von seinen finanziellen Unterstützern. „Pink Money“, zwei seiner wichtigsten Geldgeber für den Wahlkampf waren Schwule, und die haben dann gesagt: Jetzt mach mal, Obama, sonst bekommst du kein Geld. Das war der heilsame Druck. "
Heilsam hört sich das für mich gar nicht an, wenn politische Haltung durch Geld erkauft wird. Das heisst, dass nur die, die über genügend finanzielle Ressourcen verfügen, Unterstützung bekommen.
0 Kommentare in: homonationalismus ... comment ... link
Mittwoch, 21. November 2012
RAV kritisiert Buch des Neuköllner Bürgermeisters Buschkowsky
urmila, 19:33h

Der RAV schreibt in der Pressemitteilung zur Aktion:
"Das Problem heißt Rassismus! RAV kritisiert Buch des Neuköllner Bürgermeisters Buschkowsky
Das Problem heißt Rassismus!
Unter diesem Motto haben rund 30 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte am Samstag, dem 17. November 2012 im Buchladen Hugendubel am Hermannplatz eine Erklärung verlesen und das Buch des Neuköllner Bezirksbürgermeisters Heinz Buschkowsky (SPD) mit Aufklebern verschönert.
Buschkowsky trägt mit seinem Buch zu einem Klima bei, in dem Rassismus gedeiht und die gesellschaftliche Spaltung vorangetrieben wird. Zahlreiche Kundinnen und Kunden sowie das Personal hörten interessiert zu, applaudierten und diskutierten anschließend mit den Kolleginnen und Kollegen, unter ihnen auch zahlreiche RAV-Mitglieder."
0 Kommentare in: rassistisch ... comment ... link
Mittwoch, 21. November 2012
Neu Erschienen: InderKinder
urmila, 00:27h
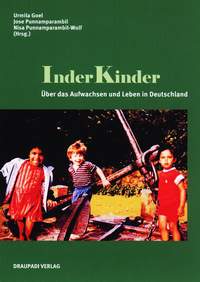
Urmila Goel, Jose Punnamparambil und Nisa Punnamparambil-Wolf (Hrsg.): InderKinder. Über das Aufwachsen und Leben in Deutschland.
Heidelberg: Draupadi Verlag, 220 Seiten, 2012, 19,80 €
ISBN 978-3-937603-73-5
„Inder, Kinder, Chip-Erfinder“ – seit der Diskussion um ‚Computer-Inder‘ und die Kampagne ‚Kinder statt Inder‘ im Jahr 2000 wird Migration aus Indien nach Deutschland auch öffentlich wahrgenommen.
In diesem Buch schreiben Kinder von Migranten und Migrantinnen aus Indien, die schon lange keine Kinder mehr sind und von denen viele schon selber Kinder haben, über das Aufwachsen und Leben als InderKind in Deutschland. Mit ihren autobiographischen Erzählungen und wissenschaftlichen Essays ermöglichen sie vielfältige Einblicke in wenig bekannte Migrationsgeschichten, in Prozesse des Anders-Gemacht-Werdens sowie dem mal mehr und mal weniger selbstbewussten Umgang mit Zuschreibungen.
Mit Beiträgen von Diptesh Banerjee, Sandra Chatterjee, Simon Chaudhuri, Betty Cherian-Oddo, Harpreet Cholia, Maymol Devasia-Demming, Urmila Goel, Renuka Jain, Rohit Jain, Nicole Karuvallil, Sherry Kizhukandayil, Merle Kröger, Paul Mecheril, Shobna Nijhawan, Rita Panesar, Nivedita Prasad, Nisa Punnamparambil-Wolf, Daniela Singhal und Pia Thattamannil.
Mehr Informationen auf urmila.de/inderkinder.
0 Kommentare in: lesen ... comment ... link
... older stories
 Foto: © Anke Illing
Foto: © Anke Illing