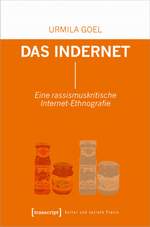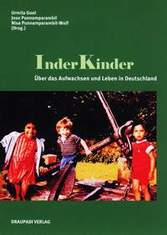... newer stories
Mittwoch, 19. Dezember 2012
Datensammlung
urmila, 18:37h
Wenn Daten erstmal gesammelt sind, dann können sie für alles mögliche genutzt werden. Zum Beispiel um eine ganze Gruppe von Menschen zu kriminalisieren:
Die taz berichtet:
"Der Innenausschuss des Europäischen Parlaments beschloss am Montagabend mit großer Mehrheit, die EU-Datenbank Eurodac für Polizei und andere Strafverfolgungsbehörden zu öffnen. Dort werden Fingerabdrücke von Asylsuchenden und Einwanderern ohne Papiere gespeichert. „Ausgerechnet Menschen, die in Europa Schutz vor Verfolgung suchen, geraten so unter Generalverdacht, Kriminelle zu sein“, sagt Ska Keller von den Grünen. "
Die taz berichtet:
"Der Innenausschuss des Europäischen Parlaments beschloss am Montagabend mit großer Mehrheit, die EU-Datenbank Eurodac für Polizei und andere Strafverfolgungsbehörden zu öffnen. Dort werden Fingerabdrücke von Asylsuchenden und Einwanderern ohne Papiere gespeichert. „Ausgerechnet Menschen, die in Europa Schutz vor Verfolgung suchen, geraten so unter Generalverdacht, Kriminelle zu sein“, sagt Ska Keller von den Grünen. "
0 Kommentare in: abschieben ... comment ... link
Asiatisch
urmila, 18:32h
Aus einer Polizei-Pressemitteilung:
"Der gesuchte Zeuge wird wie folgt beschrieben:
1 Meter 60 bis 1 Meter 70 groß
etwa 16 bis 17 Jahre alt
hat ein asiatisches Erscheinungsbild
kurze, schwarze Haare und eine schlanke Figur
er trug helle Kleidung"
Mal wieder fahndet die Polizei nach Asiatischem. Abgesehen davon, dass der Zeuge vermutlich Berliner ist und auch wie einer aussieht, hat die Berliner Polizei doch ein Recht eingeschränktes Bild von Asien. Asien ist in Deutschland immer nur (Süd)Ostasien (vgl. meinen Artikel zum Konzept 'Asiatische Deutsche').
"Der gesuchte Zeuge wird wie folgt beschrieben:
1 Meter 60 bis 1 Meter 70 groß
etwa 16 bis 17 Jahre alt
hat ein asiatisches Erscheinungsbild
kurze, schwarze Haare und eine schlanke Figur
er trug helle Kleidung"
Mal wieder fahndet die Polizei nach Asiatischem. Abgesehen davon, dass der Zeuge vermutlich Berliner ist und auch wie einer aussieht, hat die Berliner Polizei doch ein Recht eingeschränktes Bild von Asien. Asien ist in Deutschland immer nur (Süd)Ostasien (vgl. meinen Artikel zum Konzept 'Asiatische Deutsche').
0 Kommentare in: othering ... comment ... link
Mittwoch, 12. Dezember 2012
Verschiedenes zu Abschieben / Antiziganismus
urmila, 23:27h
Die taz berlin hat Martina Mauer vom Berliner Flüchtlingsrat zu fehlenden Unterkünften von Asylbewerbenden interviewt. Lesenswert:
"Berlin hat kein Asylbewerberproblem - Berlin hat ein Wohnungsproblem und eine überforderte Verwaltung."
In der gleichen Ausgabe schreibt die taz berlin über die Abschiebung von (zumeist) Roma nach Serbien und Mazedonien: "In die Kälte abgeschoben".
Die taz berichtet auch über die Forderungen von Roma und Sinti-Aktivist_innen in Deutschland, gegen Antiziganismus vorzugehen:
"Sinti und Roma leben seit 600 Jahren in diesem Land, wir müssen nicht integriert werden", sagt Daniel Strauß dazu. "Aber wir haben nicht die gleichen Chancen auf Teilhabe. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass rund die Hälfte der deutschen Sinti und Roma in sozialen Brennpunkt-Quartieren leben."
"Berlin hat kein Asylbewerberproblem - Berlin hat ein Wohnungsproblem und eine überforderte Verwaltung."
In der gleichen Ausgabe schreibt die taz berlin über die Abschiebung von (zumeist) Roma nach Serbien und Mazedonien: "In die Kälte abgeschoben".
Die taz berichtet auch über die Forderungen von Roma und Sinti-Aktivist_innen in Deutschland, gegen Antiziganismus vorzugehen:
"Sinti und Roma leben seit 600 Jahren in diesem Land, wir müssen nicht integriert werden", sagt Daniel Strauß dazu. "Aber wir haben nicht die gleichen Chancen auf Teilhabe. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass rund die Hälfte der deutschen Sinti und Roma in sozialen Brennpunkt-Quartieren leben."
0 Kommentare in: abschieben ... comment ... link
Samstag, 8. Dezember 2012
Kein Rassismusproblem?
urmila, 23:51h
Im taz-Interview erklärt Astrid Jacobsen, Professorin an der Polizeiakademie:
"Die Polizei hat kein strukturelles Rassismusproblem."
Im ihren folgenden Ausführungen analysiert sie dann, wie Polizist_innen (als Teil der deutschen Gesellschaft) in ihrer Arbeit Rassismen reproduzieren (mit massiven Folgen):
"Leider werden dann immer wieder gängige Vorurteile und Klischees herangezogen, die auch an sichtbaren Merkmalen ethnischer Zugehörigkeit festgemacht werden. Bestimmtes kriminelles Verhalten wird mit bestimmten Gruppen verbunden. Beispielsweise Russen mit Gewalt, dunkle Hautfarbe mit Aufenthaltsdelikten etc."
Jacobsen bedauert explizit, dass die Debatte um die falschen (rassistischen) Verdächtigungen bei den NSU-Morden so schnell abgeklungen ist. In vielem kann ich ihrer Analyse zustimmen. Nur eben nicht in der Feststellung, dass es kein Rassismusproblem bei der Polizei gebe. Rassismus scheint sie anders als in der kritischen Rassismustheorie zu definieren. Weil sie letztere nicht kennt? Weil sie sie nicht gut findet? Oder weil sie die Polizei nicht als Rassismus reproduzierend bezeichnen darf?
Wenn das strukturelle Problem nicht als Rassismus benannt wird, dann kann das Problem auch nicht bekämpft werden.
Nachtrag 11.12.12: publikative.org hat das Interview auch analysiert:
"Kurzum: Ein eigentlich lesenswertes Interview – mit absurder Schlussfolgerung. Würde die Polizeiwissenschaftlerin statt von Klischees von Rassismus sprechen: Der Skandal wäre garantiert. Schade, dass die taz nicht noch eine Frage gestellt hat: Warum in aller Welt soll das von Jacobsen Geschilderte eigentlich kein Rassismus sein?!"
"Die Polizei hat kein strukturelles Rassismusproblem."
Im ihren folgenden Ausführungen analysiert sie dann, wie Polizist_innen (als Teil der deutschen Gesellschaft) in ihrer Arbeit Rassismen reproduzieren (mit massiven Folgen):
"Leider werden dann immer wieder gängige Vorurteile und Klischees herangezogen, die auch an sichtbaren Merkmalen ethnischer Zugehörigkeit festgemacht werden. Bestimmtes kriminelles Verhalten wird mit bestimmten Gruppen verbunden. Beispielsweise Russen mit Gewalt, dunkle Hautfarbe mit Aufenthaltsdelikten etc."
Jacobsen bedauert explizit, dass die Debatte um die falschen (rassistischen) Verdächtigungen bei den NSU-Morden so schnell abgeklungen ist. In vielem kann ich ihrer Analyse zustimmen. Nur eben nicht in der Feststellung, dass es kein Rassismusproblem bei der Polizei gebe. Rassismus scheint sie anders als in der kritischen Rassismustheorie zu definieren. Weil sie letztere nicht kennt? Weil sie sie nicht gut findet? Oder weil sie die Polizei nicht als Rassismus reproduzierend bezeichnen darf?
Wenn das strukturelle Problem nicht als Rassismus benannt wird, dann kann das Problem auch nicht bekämpft werden.
Nachtrag 11.12.12: publikative.org hat das Interview auch analysiert:
"Kurzum: Ein eigentlich lesenswertes Interview – mit absurder Schlussfolgerung. Würde die Polizeiwissenschaftlerin statt von Klischees von Rassismus sprechen: Der Skandal wäre garantiert. Schade, dass die taz nicht noch eine Frage gestellt hat: Warum in aller Welt soll das von Jacobsen Geschilderte eigentlich kein Rassismus sein?!"
2 Kommentare in: rassistisch ... comment ... link
Ferienwohnung 'India'
urmila, 23:30h

Die Ferienwohnung war gut. Gut, um mich für den Workshop am nächsten Tag vorzubereiten, etwas abzuschalten, gut zu schlafen. Gleichzeitig war sie interesanntes Anschauungsmaterial. Mal wieder eine Gelegenheit für teilnehmende Beobachtung. Interessantes Indienbild der Gestalterin. Das obligatorische Taj, ein Mosikitonetz, Elefanten, Buddhas und dann noch so einiges, was wohl irgendwie asiatisch sein sollte.

0 Kommentare in: orientalismus ... comment ... link
Sonntag, 2. Dezember 2012
Konservativ
urmila, 00:57h
Die taz zitiert in dem Artikel "CDU-Rebellen kämpfen für Homopaare" den CDU-Bundestagsabgeordneten Jan-Marco Luczak:
„Schwule und Lesben, die eine Lebenspartnerschaft eingehen, übernehmen genauso Verantwortung füreinander wie Ehepaare“, sagte Luczak am Donnerstag. „Sie leben konservative Werte.“
Genau diese Reproduktion von konservativen Werten ist ein Problem für progressive emanzipative Politik.
„Schwule und Lesben, die eine Lebenspartnerschaft eingehen, übernehmen genauso Verantwortung füreinander wie Ehepaare“, sagte Luczak am Donnerstag. „Sie leben konservative Werte.“
Genau diese Reproduktion von konservativen Werten ist ein Problem für progressive emanzipative Politik.
2 Kommentare in: homonationalismus ... comment ... link
Donnerstag, 29. November 2012
Berlin leistet sich was
urmila, 16:52h
Berlin mag arm sein, leistet es sich aber ordentlich in die Festung Europa zu investieren. Laut taz berlin :
"11 Millionen Euro kostet der Abschiebeknast das Land Berlin pro Jahr. [...] Den Löwenanteil verschlingen dabei die Personalkosten für die 181 Bediensteten mit 9,4 Millionen Euro. Die Miete beträgt 1,5 Millionen Euro."
Und das bei derzeit 13 Abschiebehäfltingen (im Oktober war zeitweise nur einer drinnen). Das soll nochmal jemand sagen, die Ausländer nehmen Arbeitsplätze weg. Ganz eindeutig schaffen sie welche.
Abschiebehaft ist nicht nur menschenunwürdig, sie ist auch eine Geldverschwendung.
"11 Millionen Euro kostet der Abschiebeknast das Land Berlin pro Jahr. [...] Den Löwenanteil verschlingen dabei die Personalkosten für die 181 Bediensteten mit 9,4 Millionen Euro. Die Miete beträgt 1,5 Millionen Euro."
Und das bei derzeit 13 Abschiebehäfltingen (im Oktober war zeitweise nur einer drinnen). Das soll nochmal jemand sagen, die Ausländer nehmen Arbeitsplätze weg. Ganz eindeutig schaffen sie welche.
Abschiebehaft ist nicht nur menschenunwürdig, sie ist auch eine Geldverschwendung.
0 Kommentare in: abschieben ... comment ... link
Äpfel und Birnen
urmila, 16:43h
In einem taz-Artikel über die Abwesenheit von biodeutschen Kindern in Klassen mit Kindern mit dem sogenannten Migrationshintergrund werden Äpfel mit Birnen verglichen:
"Doch Mittelschichtseltern sind enorm findig, wenn es darum geht, ihren Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen. [...] Eltern mit Migrationshintergrund wissen oft gar nicht, dass ihnen diese Möglichkeit offensteht."
taz-Autor Daniel Bax stellt hier den Mittelschichtseltern den Eltern mit Migrationshintergrund gegenüber. Als ob es keine Mittelschichtseltern mit Migrationshintergrund gebe. Damit bildet Bax die Debatte wahrscheinlich gut ab.
"Doch Mittelschichtseltern sind enorm findig, wenn es darum geht, ihren Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen. [...] Eltern mit Migrationshintergrund wissen oft gar nicht, dass ihnen diese Möglichkeit offensteht."
taz-Autor Daniel Bax stellt hier den Mittelschichtseltern den Eltern mit Migrationshintergrund gegenüber. Als ob es keine Mittelschichtseltern mit Migrationshintergrund gebe. Damit bildet Bax die Debatte wahrscheinlich gut ab.
0 Kommentare in: interdependenz ... comment ... link
Mittwoch, 28. November 2012
Mädchenmordendes Indien
urmila, 17:38h
Im Februar war ich Gast auf einer feministischen Konferenz in Indien und schrieb auf dem Blog suedasien.info unter anderem:
"Im Panel über pränatale (und präzeugungs) Diagnostik (mit Mary John, Anita Ghai, Rennu Khanna und Farah Nagvi) wurde die Verquickung von Kampagnen gegen die Abtreibung weiblicher Föten zum einen mit Anti-Abtreibungs-Kampagnen sowie zum anderen mit eugenischem Aussortieren von unwertem Leben herausgearbeitet. Es wurde kritisiert, dass viele Interventionen gegen die Abtreibung weiblicher Föten letztendlich heteronormativitätsstabilisierend wirken. Für feministische Politiken wurde gefordert, dass nicht an den Syptomen (den Abtreibungen) zu arbeiten sei, sondern die grundlegende Abwertung von Frauen thematisiert und bekämpft werden müsse."
Die Abtreibung weiblicher Föten ist ein gesellschaftspolitisches Thema in Indien, es gibt staatliche Massnahmen dagegen (so ist zum Beispiel die pränatale Geschlechtsbestimmung verboten), es gibt Engagement dagegen und trotzdem gibt es die Praxis weiter. Es ist also ein wichtiges Thema.
So wie Georg Blume das Thema heute in der taz aufgreift, kommt die Diskussion allerdings nicht weiter. Es ist mal wieder einer von Blumes komplexitätsreduzierenden exotisierenden Indienartikeln, die im wesentlichen belegen, wie furchtbar Indien ist. Indem aktuellen Artikel "Eine Frau wehrt sich" tut Blume so, als ob die von ihm porträtierte Mitu Khurana die einzige Inderin wäre, die sich gegen die Abtreibung weiblicher Föten engagiere. Nun könnte es sein, dass Blume es nicht besser weiss (was bedenklich wäre, denn von einem seriösen Journalisten würde ich Recherche erwarten).
Aber dem ist nicht so, im März dieses Jahres hat Blume schon einen Artikel mit der gleichen Protagonistin in der Zeit veröffentlicht und da immerhin auf das gesetzliche Verbot der pränatalen Geschlechtsbestimmung, auf eine Rede des Ministerpräsidenten und weiteres Engagement gegen die Praxis hingewiesen (auch der Artikel ist allerdings pauschalisierend und abwertend). Blume weiss es also besser, was es noch fraglicher macht, warum er im taz so tut als ob Khurana und er die Einzigen wären, die das Thema öffentlich machen.
Befremdlich ist auch, dass die Print-taz auf der Titelseite mit der Schlagzeile "Die Abtreibungsgegnerin" auf den Artikel hinweist. Das schliesst an das Panel bei der feministischen Konferenz an. Der Kampf gegen ein patriarchales System wird missbraucht, um das Recht auf Abtreibung in Frage zu stellen.
"Im Panel über pränatale (und präzeugungs) Diagnostik (mit Mary John, Anita Ghai, Rennu Khanna und Farah Nagvi) wurde die Verquickung von Kampagnen gegen die Abtreibung weiblicher Föten zum einen mit Anti-Abtreibungs-Kampagnen sowie zum anderen mit eugenischem Aussortieren von unwertem Leben herausgearbeitet. Es wurde kritisiert, dass viele Interventionen gegen die Abtreibung weiblicher Föten letztendlich heteronormativitätsstabilisierend wirken. Für feministische Politiken wurde gefordert, dass nicht an den Syptomen (den Abtreibungen) zu arbeiten sei, sondern die grundlegende Abwertung von Frauen thematisiert und bekämpft werden müsse."
Die Abtreibung weiblicher Föten ist ein gesellschaftspolitisches Thema in Indien, es gibt staatliche Massnahmen dagegen (so ist zum Beispiel die pränatale Geschlechtsbestimmung verboten), es gibt Engagement dagegen und trotzdem gibt es die Praxis weiter. Es ist also ein wichtiges Thema.
So wie Georg Blume das Thema heute in der taz aufgreift, kommt die Diskussion allerdings nicht weiter. Es ist mal wieder einer von Blumes komplexitätsreduzierenden exotisierenden Indienartikeln, die im wesentlichen belegen, wie furchtbar Indien ist. Indem aktuellen Artikel "Eine Frau wehrt sich" tut Blume so, als ob die von ihm porträtierte Mitu Khurana die einzige Inderin wäre, die sich gegen die Abtreibung weiblicher Föten engagiere. Nun könnte es sein, dass Blume es nicht besser weiss (was bedenklich wäre, denn von einem seriösen Journalisten würde ich Recherche erwarten).
Aber dem ist nicht so, im März dieses Jahres hat Blume schon einen Artikel mit der gleichen Protagonistin in der Zeit veröffentlicht und da immerhin auf das gesetzliche Verbot der pränatalen Geschlechtsbestimmung, auf eine Rede des Ministerpräsidenten und weiteres Engagement gegen die Praxis hingewiesen (auch der Artikel ist allerdings pauschalisierend und abwertend). Blume weiss es also besser, was es noch fraglicher macht, warum er im taz so tut als ob Khurana und er die Einzigen wären, die das Thema öffentlich machen.
Befremdlich ist auch, dass die Print-taz auf der Titelseite mit der Schlagzeile "Die Abtreibungsgegnerin" auf den Artikel hinweist. Das schliesst an das Panel bei der feministischen Konferenz an. Der Kampf gegen ein patriarchales System wird missbraucht, um das Recht auf Abtreibung in Frage zu stellen.
0 Kommentare in: interdependenz ... comment ... link
Problematische Vergleiche
urmila, 17:14h
Die taz berichtet über den prekären Status von Nachwuchswissenschaftler_innen in Deutschland. Ein wichtiges Thema - an den Unis läuft es richtig schief. Trotzdem sollte mensch vorsichtig sein, wie sie das Problem definiert. Die taz zitiert eine Doktorandin wie folgt:
" "Unmöglich, an die Promotion zu denken, wenn man so viel verdient wie KassiererInnen an der Supermarktkasse"
Was soll das heissen? Wieso kann mensch da nicht an die Promotion denken? Wenn die Kassierer_innen davon leben können, dann müssten es Doktorand_innen auch können (vorallem weil sie Aufstiegschancen haben, die Kassierer_innen nicht haben). Oder aber auch Kassierer_innen können davon nicht leben.
Was will die Doktorandin sagen? Dass ihr Gehalt zu gering ist und sie noch andere Jobs braucht, um über die Runden zu kommen? Dann sollte sie sich mit den Kassierer_innen verbünden. Oder dass die kurzfristigen Verträge ihr keine Planungsperspektive geben? Dann braucht es den Verweis auf Kassierer_innen nicht. Oder dass Forschung nicht ausreichend finanziell gewürdigt wird? Dann lässt sich natürlich klassistisch auf die Kassierer_innen runterschauen.
" "Unmöglich, an die Promotion zu denken, wenn man so viel verdient wie KassiererInnen an der Supermarktkasse"
Was soll das heissen? Wieso kann mensch da nicht an die Promotion denken? Wenn die Kassierer_innen davon leben können, dann müssten es Doktorand_innen auch können (vorallem weil sie Aufstiegschancen haben, die Kassierer_innen nicht haben). Oder aber auch Kassierer_innen können davon nicht leben.
Was will die Doktorandin sagen? Dass ihr Gehalt zu gering ist und sie noch andere Jobs braucht, um über die Runden zu kommen? Dann sollte sie sich mit den Kassierer_innen verbünden. Oder dass die kurzfristigen Verträge ihr keine Planungsperspektive geben? Dann braucht es den Verweis auf Kassierer_innen nicht. Oder dass Forschung nicht ausreichend finanziell gewürdigt wird? Dann lässt sich natürlich klassistisch auf die Kassierer_innen runterschauen.
0 Kommentare in: klasse ... comment ... link
Samstag, 24. November 2012
Mehr Frauen?
urmila, 20:09h
Das DIW betitelt eine Pressemitteilung mit "Auto-Mobilität: Mehr Frauen und ältere Menschen am Steuer". In der taz ist dazu zu lesen:
"Frauen - über alle Altersgruppen gesehen - nennen häufiger ein privates Kraftfahrzeug ihr Eigen und nutzen es auch öfter als vor zehn Jahren, während Männer diesbezüglich bescheidener geworden sind."
Irgendwie bekomme ich beim Lesen das Gefühl, dass Frauen jetzt besonders häufig hinter dem Lenkrad sitzen. Dass sie im Gegensatz zu Männern nicht umweltbewusster werden und häufiger andere Verkehrsmittel wählen. Die Frauen als Umweltsäue.
Sowohl der taz-Artikel wie die DIW-Pressemitteilung zeigen aber mal wieder die Schwierigkeiten der Interpretation von statistischen Daten. In der Pressemitteilung steht:
"Frauen spielen eine immer wichtigere Rolle im Pkw-Verkehr: Auf 1 000 Frauen kommen heute 400 Autos, vor zehn Jahren waren es rund 280 Autos. 1 000 Männer teilen sich rechnerisch etwa 715 Fahrzeuge."
Die Überschrift dazu könnte auch lauten: "Fast doppelt so viele Männer haben Autos". Denn 715 von 1000 Männer haben ein Auto, aber nur 400 von 1000 Frauen. Wieviele Autos 1000 Männer vor zehn Jahren hatten, teilt die Pressemitteilung nicht mit. Auf dieser Grundlage kann ich also nicht feststellen, wie sich das Verhältnis von Frauen-Autos zu Männer-Autos verändert hat. Ist es gleich geblieben? Hat sich der Abstand verringert oder vergrößert? Wenn diese Information vorliegen würde, liesse sich etwas über die Veränderung des Gender-Unterschieds aussagen.
Auf Basis der vorliegenden Statistik liesse sich auch titeln: "Frauen weiterhin viel umweltbewusster als Männer - sie verweigern sich der Angleichung im Autobesitz" oder "Frauen scheinen weiterhin über weniger ökonomische Ressourcen zu verfügen" oder ....
Anhand der explizit angebenen Statistiken lässt sich schön sehen, wer als normal angesehen wird und deswegen nicht besonders betrachtet werden muss: der mittelalte Mann. Über den erfahren wir nur indirekt etwas, dadurch das die Jungen, die Alten und die Frauen in Bezug zu ihm gesetzt werden.
Dass Männer bescheidener geworden sind, kann ich aus den Daten hingegen nicht ersehen.
"Frauen - über alle Altersgruppen gesehen - nennen häufiger ein privates Kraftfahrzeug ihr Eigen und nutzen es auch öfter als vor zehn Jahren, während Männer diesbezüglich bescheidener geworden sind."
Irgendwie bekomme ich beim Lesen das Gefühl, dass Frauen jetzt besonders häufig hinter dem Lenkrad sitzen. Dass sie im Gegensatz zu Männern nicht umweltbewusster werden und häufiger andere Verkehrsmittel wählen. Die Frauen als Umweltsäue.
Sowohl der taz-Artikel wie die DIW-Pressemitteilung zeigen aber mal wieder die Schwierigkeiten der Interpretation von statistischen Daten. In der Pressemitteilung steht:
"Frauen spielen eine immer wichtigere Rolle im Pkw-Verkehr: Auf 1 000 Frauen kommen heute 400 Autos, vor zehn Jahren waren es rund 280 Autos. 1 000 Männer teilen sich rechnerisch etwa 715 Fahrzeuge."
Die Überschrift dazu könnte auch lauten: "Fast doppelt so viele Männer haben Autos". Denn 715 von 1000 Männer haben ein Auto, aber nur 400 von 1000 Frauen. Wieviele Autos 1000 Männer vor zehn Jahren hatten, teilt die Pressemitteilung nicht mit. Auf dieser Grundlage kann ich also nicht feststellen, wie sich das Verhältnis von Frauen-Autos zu Männer-Autos verändert hat. Ist es gleich geblieben? Hat sich der Abstand verringert oder vergrößert? Wenn diese Information vorliegen würde, liesse sich etwas über die Veränderung des Gender-Unterschieds aussagen.
Auf Basis der vorliegenden Statistik liesse sich auch titeln: "Frauen weiterhin viel umweltbewusster als Männer - sie verweigern sich der Angleichung im Autobesitz" oder "Frauen scheinen weiterhin über weniger ökonomische Ressourcen zu verfügen" oder ....
Anhand der explizit angebenen Statistiken lässt sich schön sehen, wer als normal angesehen wird und deswegen nicht besonders betrachtet werden muss: der mittelalte Mann. Über den erfahren wir nur indirekt etwas, dadurch das die Jungen, die Alten und die Frauen in Bezug zu ihm gesetzt werden.
Dass Männer bescheidener geworden sind, kann ich aus den Daten hingegen nicht ersehen.
0 Kommentare in: statistik ... comment ... link
... older stories
 Foto: © Anke Illing
Foto: © Anke Illing