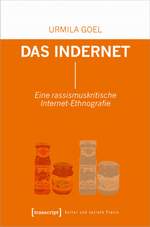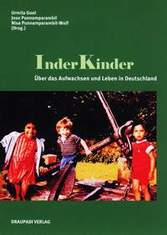... newer stories
Freitag, 1. Juni 2012
Topmodels
urmila, 20:15h
taz-Autorin Steffi Dobmeier schaut mit Ex-Model und Ex-Modelvermittlerin Rita Jaeger "Germany's Next Topmodel" und schreibt darüber in der taz. Jetzt stellt sich die Frage: Warum? Zu den Topmodels liessen sich sicher spannende Artikel (und viele nicht spannende) schreiben. Vielleicht sogar mit einem Bezug zu Rita Jaeger. Aber mit deren Aussagen gibt es im Artikel überhaupt keinen kritischen Umgang. Unkommentiert werden sexistische (und lookistische) Aussagen abgedruckt:
"Nee, die ist doch nicht hübsch. Die ist ja fast schon hässlich. Wobei, na ja, das wäre übertrieben. Mir ist sie einfach ein bisschen zu derb, aber das ist Geschmackssache. Sie hat auf jeden Fall eine ungünstige Kinnpartie. Das wird mal ein Doppelkinn, wenn sie nicht aufpasst. "
oder
"Diese Waden! Viel zu muskulös. Nein, das geht gar nicht. "
oder
"Models müssen weiblich sein und elegant. "
Für Analysen ist dieser Artikel echt spannend. Wie die eine Inszenierung die andere Inszenierung kommentiert. Was wie thematisiert wird und was nicht. Aber als Zeitungsartikel fehlt mir die kritische Distanz.
"Nee, die ist doch nicht hübsch. Die ist ja fast schon hässlich. Wobei, na ja, das wäre übertrieben. Mir ist sie einfach ein bisschen zu derb, aber das ist Geschmackssache. Sie hat auf jeden Fall eine ungünstige Kinnpartie. Das wird mal ein Doppelkinn, wenn sie nicht aufpasst. "
oder
"Diese Waden! Viel zu muskulös. Nein, das geht gar nicht. "
oder
"Models müssen weiblich sein und elegant. "
Für Analysen ist dieser Artikel echt spannend. Wie die eine Inszenierung die andere Inszenierung kommentiert. Was wie thematisiert wird und was nicht. Aber als Zeitungsartikel fehlt mir die kritische Distanz.
0 Kommentare in: heteronormativ ... comment ... link
Samstag, 26. Mai 2012
Europa gleich Gut
urmila, 20:33h
Die taz lässt Jan Feddersen und Stefan Niggemeier Pro und Con zur Berichterstattung über den ESC schreiben.
Feddersens Verharmlosung von Menschenrechtsverletzungen kommt nicht überaschend. Er folgt dabei seiner ganz eigenen Logik, die durch antimuslimischen Rassismus und Homonationalismus angetrieben wird. Er beginnt seinen Text mit:
"Zunächst zu den Fakten: Dieses Land Aserbaidschan am Kaspischen Meer ist im Vergleich zu seinen Nachbarn nicht nur auf den ersten Blick eine westlich anmutende Oase.
Über die Demokratiedefizite Russlands, über die theokratischen Despoten in Iran oder über das auch nicht gerade plurale Georgien muss man kein Wort verlieren. Eher noch über die Türkei – im Gegensatz zu dieser wird in Aserbaidschan eine strikte Trennung von Staat und Religion geachtet.
Baku sieht westlich aus, Kopftücher bei Frauen sind rar, Schwule und Lesben werden durch kein Gesetz verfolgt."
Zentrales Element ist hier die Gleichsetzung von Westen mit Europa mit Gut (gegen Kopftücher und für Schwule?). Und da sieht Feddersen auch das Potential des ESC für Aserbaidschan:
"Wer momentan in Baku übersieht, dass auch durch den ESC die Stadt quasi europäisch „infiziert“, ja „gequeert“ wird, verkennt das Politische am ESC."
Europa ist als etwas infektiöses und hat was mit Queer zu tun? Es fällt mir schwer, Feddersen zu verstehen.
Niggemeier gibt Feddersen Contra und argumentiert, dass Menschenrechtsverletzungen in Aserbaidschan thematisiert werden müssen. Aber auch er argumentiert mit seltsamen Europa-Verweisen und gleicht Feddersen da erschreckend:
"Der Grand Prix ist für das autoritär herrschende Regime eine Fassade, um sich der Öffentlichkeit als europäisch, modern und weltoffen zu präsentieren. Einiges in Baku ist verblüffend europäisch.
Doch viele europäische Werte und Ideale zählen hier nichts. "
Auch hier ist Europa gleichgesetzt mit Gut (modern, weltoffen, Werte, Ideale). Auch hier werden 'wir' (Europa) gegen 'die' (der Osten? die Menschrechtsverletzenden? - bei Feddersen sind das die 'Muslime') positioniert - und sind 'wir' natürlich überlegen.
Eine Seite weiter geht es in der Print-taz mit der Überhöhung eines imaginären Europas, das 'wir' sind, weiter. In einem Artikel über einen Skeptiker-Konferenz heisst es:
"Was in der Mitte Europas vielleicht als Kampf auf gesellschaftlichen Nebenschauplätzen abgetan werden kann, nimmt sich an seinen Rändern und in Entwicklungsländern dramatisch aus."
Auch hier Europa bzw. die Mitte Europas ('wir') als Zentrum der Vernunft, des Fortschritts, etc. und dagegen stehen die 'Anderen', die sich noch weiter entwickeln müssen. Diese Weltsicht scheint tatsächlich hoch infektiös zu sein und fundierte Argumentationen überflüssig zu machen.
Feddersens Verharmlosung von Menschenrechtsverletzungen kommt nicht überaschend. Er folgt dabei seiner ganz eigenen Logik, die durch antimuslimischen Rassismus und Homonationalismus angetrieben wird. Er beginnt seinen Text mit:
"Zunächst zu den Fakten: Dieses Land Aserbaidschan am Kaspischen Meer ist im Vergleich zu seinen Nachbarn nicht nur auf den ersten Blick eine westlich anmutende Oase.
Über die Demokratiedefizite Russlands, über die theokratischen Despoten in Iran oder über das auch nicht gerade plurale Georgien muss man kein Wort verlieren. Eher noch über die Türkei – im Gegensatz zu dieser wird in Aserbaidschan eine strikte Trennung von Staat und Religion geachtet.
Baku sieht westlich aus, Kopftücher bei Frauen sind rar, Schwule und Lesben werden durch kein Gesetz verfolgt."
Zentrales Element ist hier die Gleichsetzung von Westen mit Europa mit Gut (gegen Kopftücher und für Schwule?). Und da sieht Feddersen auch das Potential des ESC für Aserbaidschan:
"Wer momentan in Baku übersieht, dass auch durch den ESC die Stadt quasi europäisch „infiziert“, ja „gequeert“ wird, verkennt das Politische am ESC."
Europa ist als etwas infektiöses und hat was mit Queer zu tun? Es fällt mir schwer, Feddersen zu verstehen.
Niggemeier gibt Feddersen Contra und argumentiert, dass Menschenrechtsverletzungen in Aserbaidschan thematisiert werden müssen. Aber auch er argumentiert mit seltsamen Europa-Verweisen und gleicht Feddersen da erschreckend:
"Der Grand Prix ist für das autoritär herrschende Regime eine Fassade, um sich der Öffentlichkeit als europäisch, modern und weltoffen zu präsentieren. Einiges in Baku ist verblüffend europäisch.
Doch viele europäische Werte und Ideale zählen hier nichts. "
Auch hier ist Europa gleichgesetzt mit Gut (modern, weltoffen, Werte, Ideale). Auch hier werden 'wir' (Europa) gegen 'die' (der Osten? die Menschrechtsverletzenden? - bei Feddersen sind das die 'Muslime') positioniert - und sind 'wir' natürlich überlegen.
Eine Seite weiter geht es in der Print-taz mit der Überhöhung eines imaginären Europas, das 'wir' sind, weiter. In einem Artikel über einen Skeptiker-Konferenz heisst es:
"Was in der Mitte Europas vielleicht als Kampf auf gesellschaftlichen Nebenschauplätzen abgetan werden kann, nimmt sich an seinen Rändern und in Entwicklungsländern dramatisch aus."
Auch hier Europa bzw. die Mitte Europas ('wir') als Zentrum der Vernunft, des Fortschritts, etc. und dagegen stehen die 'Anderen', die sich noch weiter entwickeln müssen. Diese Weltsicht scheint tatsächlich hoch infektiös zu sein und fundierte Argumentationen überflüssig zu machen.
1 Kommentar in: orientalismus ... comment ... link
Mittel gegen 'Ausländerkriminalität'
urmila, 20:02h
Die taz berichtet aus Israel:
"Einzig Polizeigeneralinspektor Jochanan Danino schlug vor, Flüchtlingen Papiere zu geben und sie arbeiten zu lassen. Nur so seien sie nicht länger zum Stehlen gezwungen. Innenminister Eli Ischai (Schass-Partei) nannte den Vorschlag, „eine schreckliche Botschaft", die „eine Million weitere Flüchtlinge" nach Israel bringen werde. Die Tageszeitung Maariw bezeichnete Danino hingegen als „den einzigen weisen Mann innerhalb der xenophoben Regierungskreise"."
Nachtrag 17.06.12: Die Politik folgt aber nicht dem Polizeigeneralinspektor sondern schiebt ab, wie die taz berichtet.
"Einzig Polizeigeneralinspektor Jochanan Danino schlug vor, Flüchtlingen Papiere zu geben und sie arbeiten zu lassen. Nur so seien sie nicht länger zum Stehlen gezwungen. Innenminister Eli Ischai (Schass-Partei) nannte den Vorschlag, „eine schreckliche Botschaft", die „eine Million weitere Flüchtlinge" nach Israel bringen werde. Die Tageszeitung Maariw bezeichnete Danino hingegen als „den einzigen weisen Mann innerhalb der xenophoben Regierungskreise"."
Nachtrag 17.06.12: Die Politik folgt aber nicht dem Polizeigeneralinspektor sondern schiebt ab, wie die taz berichtet.
0 Kommentare in: abschieben ... comment ... link
Mittwoch, 23. Mai 2012
Wo bleibt der Rechtsstaat?
urmila, 13:32h
"Organisationen, die im Verfassungsschutzbericht aufgelistet sind, sollen künftig automatisch die Gemeinnützigkeit verlieren." berichtet die taz.
Das heisst, ohne Urteil, alleine aufgrund eines Verdachts, der zudem nicht nachvollziehbar begründet wird (weil der Verfassungsschutz seine Quellen nicht offenlegen muss), gibt es automatisch finanzrechtliche Konsequenzen. (Und das zu einer Zeit, wo gerade sogar öffentlich über das Versagen des Verfassungsschutz im Fall der NSU diskutiert wird.) Wie lässt sich das mit dem Rechtsstaat vereinbaren? Mit der Trennung von Exekutive, Legislative und Judikative?
Bei der jetzt geplanten rechtlichen Änderung geht es um ein Wort wie die taz berichtet: "Bisher wurde „widerlegbar“ vermutet, dass eine im Verfassungsschutzbericht als extremistisch erwähnte Organisation nicht gemeinnützig sein kann. Jetzt soll das Wort „widerlegbar“ gestrichen werden. Die Finanzämter hätten dann keinen Ermessensspielraum mehr."
Das heisst aber, dass auch schon bisher eine rechtsstaatlich zweifelhafte Regelung gilt. Wieso kann dem nicht überprüfbaren Verfassungsberichten solche Bedeutung zugeschrieben werden? Wieso folgen aus dem Bericht fast automatisch finanzrechtliche Folgen?
Die Klausel gibt es laut taz seit 2008. Sie wurde wohl ohne großen Protest eingeführt, weil es (angeblich) um Neonazis ging. Jetzt berichtet zumindest die taz über Protest:
"Wolfgang Neskovic, Justiziar der Linken im Bundestag, ist empört. „Diese Regelung öffnet die Tür für politische Willkür“, meint der ehemalige Richter am Bundesgerichtshof, „über die Nennung im Verfassungsschutzbericht könnte dann gezielt missliebigen politischen Vereinigungen der finanzielle Boden entzogen werden.“ "
Und die taz führt noch aus:
"Außerdem können schon Lappalien zur Aufnahme in den Verfassungsschutzbericht führen, etwa wenn eine Organisation auf ihrer Webseite Links zu extremistischen Organisationen gesetzt hat. "
Das heisst, ohne Urteil, alleine aufgrund eines Verdachts, der zudem nicht nachvollziehbar begründet wird (weil der Verfassungsschutz seine Quellen nicht offenlegen muss), gibt es automatisch finanzrechtliche Konsequenzen. (Und das zu einer Zeit, wo gerade sogar öffentlich über das Versagen des Verfassungsschutz im Fall der NSU diskutiert wird.) Wie lässt sich das mit dem Rechtsstaat vereinbaren? Mit der Trennung von Exekutive, Legislative und Judikative?
Bei der jetzt geplanten rechtlichen Änderung geht es um ein Wort wie die taz berichtet: "Bisher wurde „widerlegbar“ vermutet, dass eine im Verfassungsschutzbericht als extremistisch erwähnte Organisation nicht gemeinnützig sein kann. Jetzt soll das Wort „widerlegbar“ gestrichen werden. Die Finanzämter hätten dann keinen Ermessensspielraum mehr."
Das heisst aber, dass auch schon bisher eine rechtsstaatlich zweifelhafte Regelung gilt. Wieso kann dem nicht überprüfbaren Verfassungsberichten solche Bedeutung zugeschrieben werden? Wieso folgen aus dem Bericht fast automatisch finanzrechtliche Folgen?
Die Klausel gibt es laut taz seit 2008. Sie wurde wohl ohne großen Protest eingeführt, weil es (angeblich) um Neonazis ging. Jetzt berichtet zumindest die taz über Protest:
"Wolfgang Neskovic, Justiziar der Linken im Bundestag, ist empört. „Diese Regelung öffnet die Tür für politische Willkür“, meint der ehemalige Richter am Bundesgerichtshof, „über die Nennung im Verfassungsschutzbericht könnte dann gezielt missliebigen politischen Vereinigungen der finanzielle Boden entzogen werden.“ "
Und die taz führt noch aus:
"Außerdem können schon Lappalien zur Aufnahme in den Verfassungsschutzbericht führen, etwa wenn eine Organisation auf ihrer Webseite Links zu extremistischen Organisationen gesetzt hat. "
0 Kommentare in: kriminalisieren ... comment ... link
Montag, 21. Mai 2012
Integrationsbeauftragte
urmila, 14:59h
1997 habe ich bei der Bundesausländerbeauftragten Cornelia Schmalz-Jacobsen ein Praktikum gemacht und habe mich sehr wohl gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass sich alle Mitarbeitenden wirklich für die Anliegen der Menschen, die nach Deutschland migriert waren, und ihre Kinder einsetzten. Der Begriff der Ausländerbeauftragten wurde kritisch hinterfragt und die Umbenennung zur Integrationsbeauftragten gefordert.
Das Amt ist inzwischen umbenannt. Marieluise Beck hat sich weiter für die migrierten Menschen und ihre Kinder eingesetzt. Aber mit der konservativen Regierung scheint sich dieses Amt ziemlich geändert zu haben. 2006 habe ich zu Böhmer gebloggt und deren Pressemitteilungen abbestellt. Jetzt schreibt die taz ähnliches:
"Anders als frühere Integrationsbeauftragte wie Lieselotte Funcke von der FDP (1981–1991) oder die Grüne Marieluise Beck (1998–2005), hat sich Maria Böhmer nie als Anwältin der Migranten verstanden, deren Sorgen und Nöte sie gegenüber der Bundesregierung zur Sprache bringt. Stattdessen versteht sie sich als Sprachrohr der Bundeskanzlerin, deren Wünsche sie den Migranten durchreicht."
Aber inzwischen ist der Begriff Integration ja auch nicht mehr der Versuch mehr auf Menschen zuzugehen sondern steht für staatliche Ausgrenzungspolitik. Da passt Böhmer bestens zu.
Das Amt ist inzwischen umbenannt. Marieluise Beck hat sich weiter für die migrierten Menschen und ihre Kinder eingesetzt. Aber mit der konservativen Regierung scheint sich dieses Amt ziemlich geändert zu haben. 2006 habe ich zu Böhmer gebloggt und deren Pressemitteilungen abbestellt. Jetzt schreibt die taz ähnliches:
"Anders als frühere Integrationsbeauftragte wie Lieselotte Funcke von der FDP (1981–1991) oder die Grüne Marieluise Beck (1998–2005), hat sich Maria Böhmer nie als Anwältin der Migranten verstanden, deren Sorgen und Nöte sie gegenüber der Bundesregierung zur Sprache bringt. Stattdessen versteht sie sich als Sprachrohr der Bundeskanzlerin, deren Wünsche sie den Migranten durchreicht."
Aber inzwischen ist der Begriff Integration ja auch nicht mehr der Versuch mehr auf Menschen zuzugehen sondern steht für staatliche Ausgrenzungspolitik. Da passt Böhmer bestens zu.
0 Kommentare in: disziplinierung und ausgrenzung ... comment ... link
Samstag, 19. Mai 2012
Razan bloggt wieder
urmila, 02:05h
Vor ein paar Tagen ist sie aus dem Gefängnis gekommen und heute hat sie wieder gebloggt.
0 Kommentare in: free razan ... comment ... link
Donnerstag, 17. Mai 2012
Rechte verstehen
urmila, 00:07h
In der taz schaut Rodothea Seralidou hinter den Wahlerfolg der Rechten in Griechenland. So weit so gut, aber mich irritiert der Artikel, weil er ... ich weiss nicht genau wie es formulieren kann .... weil er zu viel Verständnis für die Rechten hat? zu sehr Rassismen verniedlicht und reproduziert?
Als Protagonisten nimmt sie einen Geschäftsmann in der Athener Innenstadt, der die Rechten gewählt hat und auch nur in ihnen Hilfe sieht. Der Artikel scheint seine Perspektive und die der Vertreter_innen der rechten Partei zu nehmen. Er reproduziert den rassistischen Blick, kategorisiert Menschen als schwarz, farbig oder arabisch aussehend, aber nicht als weiß (die sind "griechisch" und z.B. "staatlich", machen einen "netten Eindruck" oder haben "schulterlanges Haar").
Es mag nur sprachlich ungeschickt formuliert sein, aber die folgende Aussage ist trotzdem seltsam:
"Außer den illegalen Einwanderern, die sich dort winzige Wohnungen mit Dutzenden ihrer Landsleute teilen, möchte keiner freiwillig in den heruntergekommenen Innenstadtbezirk ziehen."
Die Illegalisierten ziehen sicher nicht "freiwillig" in zu kleine Wohnungen in einem heruntergekommenen Viertel, die sie sich dann auch noch mit vielen anderen teilen müssen. Sie haben vermutlich keine andere Wahl.
Und folgende Formulierungen verharmlosen, die Entscheidung rechts zu wählen:
"Es sind diese Zustände und ein Gefühl der Ohnmacht, die die Menschen dazu verleiten, ihre Hoffnung in die rechtsextreme Partei Chrysi Avgi zu legen."
und
"Muhammadi glaubt nicht, dass über Nacht etwa eine halbe Million Griechen zu Neonazis und Faschisten geworden seien. „Die meisten haben die Rechtsextremen aus Protest gewählt. Sie wollten die zwei großen Parteien damit abstrafen für die Situation, in der sich das Land heute befindet. Und für die Unsicherheit, die sie empfinden.“ "
Die Wähler_innen werden so entlastet. Sie sind nicht Schuld, sondern die Verhältnisse. Dabei könnten sie aus Protest auch ganz andere Parteien wählen (was ja auch viele gemacht haben). Das Gefühl der Unsicherheit wird als ausreichender Grund angesehen, es wird nicht weiter analysiert, warum gerade eine rechte rassistische Partei, so gut bei den Leuten ankommt. Es wird nicht weiter analysiert, wie Rassismus auch in Griechenland wohl schon lange in der Gesellschaft verankert ist.
Seralidou spricht auch nicht von Rassismus sondern von "diese Intoleranz gegenüber den Einwanderern ", nachdem sie die rassistische Einstellung des 'staatlichen' 'nett aussehenden' Rechten wiedergegeben hat:
"... will nicht zusehen, wie diese Menschen mein Land ruinieren. Sie sind illegal hier und kommen aus Ländern, in denen ein Menschenleben nichts zählt. Sie sind fähig, jemanden für nur 50 Euro umzubringen. Für mich sind sie wie Tiere. Ich kann sie nicht tolerieren!“
Als Protagonisten nimmt sie einen Geschäftsmann in der Athener Innenstadt, der die Rechten gewählt hat und auch nur in ihnen Hilfe sieht. Der Artikel scheint seine Perspektive und die der Vertreter_innen der rechten Partei zu nehmen. Er reproduziert den rassistischen Blick, kategorisiert Menschen als schwarz, farbig oder arabisch aussehend, aber nicht als weiß (die sind "griechisch" und z.B. "staatlich", machen einen "netten Eindruck" oder haben "schulterlanges Haar").
Es mag nur sprachlich ungeschickt formuliert sein, aber die folgende Aussage ist trotzdem seltsam:
"Außer den illegalen Einwanderern, die sich dort winzige Wohnungen mit Dutzenden ihrer Landsleute teilen, möchte keiner freiwillig in den heruntergekommenen Innenstadtbezirk ziehen."
Die Illegalisierten ziehen sicher nicht "freiwillig" in zu kleine Wohnungen in einem heruntergekommenen Viertel, die sie sich dann auch noch mit vielen anderen teilen müssen. Sie haben vermutlich keine andere Wahl.
Und folgende Formulierungen verharmlosen, die Entscheidung rechts zu wählen:
"Es sind diese Zustände und ein Gefühl der Ohnmacht, die die Menschen dazu verleiten, ihre Hoffnung in die rechtsextreme Partei Chrysi Avgi zu legen."
und
"Muhammadi glaubt nicht, dass über Nacht etwa eine halbe Million Griechen zu Neonazis und Faschisten geworden seien. „Die meisten haben die Rechtsextremen aus Protest gewählt. Sie wollten die zwei großen Parteien damit abstrafen für die Situation, in der sich das Land heute befindet. Und für die Unsicherheit, die sie empfinden.“ "
Die Wähler_innen werden so entlastet. Sie sind nicht Schuld, sondern die Verhältnisse. Dabei könnten sie aus Protest auch ganz andere Parteien wählen (was ja auch viele gemacht haben). Das Gefühl der Unsicherheit wird als ausreichender Grund angesehen, es wird nicht weiter analysiert, warum gerade eine rechte rassistische Partei, so gut bei den Leuten ankommt. Es wird nicht weiter analysiert, wie Rassismus auch in Griechenland wohl schon lange in der Gesellschaft verankert ist.
Seralidou spricht auch nicht von Rassismus sondern von "diese Intoleranz gegenüber den Einwanderern ", nachdem sie die rassistische Einstellung des 'staatlichen' 'nett aussehenden' Rechten wiedergegeben hat:
"... will nicht zusehen, wie diese Menschen mein Land ruinieren. Sie sind illegal hier und kommen aus Ländern, in denen ein Menschenleben nichts zählt. Sie sind fähig, jemanden für nur 50 Euro umzubringen. Für mich sind sie wie Tiere. Ich kann sie nicht tolerieren!“
0 Kommentare in: rassistisch ... comment ... link
Mittwoch, 16. Mai 2012
Neue Veröffentlichung: Migration im Europa der Regionen
urmila, 00:53h
Mein Artikel Migration im Europa der Regionen – Überlegungen zu ungleichen Machtverhältnissen und ihren Konsequenzen ist nun in der Online-Publikation Kritische Migrationsforschung? – Da kann ja jeder kommen. vom Netzwerk MiRA veröffentlicht worden.
Zusammenfassung:
Urmila Goel stellt in ihrem Artikel theoretische Überlegungen zu ungleichen und interdependenten Machtverhältnissen an, welche sie auf die Europaregionen und ihren Umgang mit Migration anwendet und daran anschließend alternative Denkansätze rund um Migration erarbeitet. Ausgangspunkt ihrer Überlegungen ist die Feststellung, dass durch die Überschreitung von Grenzen in die und innerhalb der nationalstaatlich organisierten EU Konflikte auftreten. Migration erscheint als ein Problem für die EUNationalstaaten, welches es zu regulieren bzw. zu verhindern gilt. Mit Blick auf die aktuellen Debatten über Migration stellt sie allerdings heraus, dass nicht Migration an sich, sondern die Migration von bestimmten Personen als Problem angesehen wird. In der Analyse des nach ökonomischen Kosten-Nutzen folgenden ‚Bereicherungsdiskurses’ und des ‚Integrationsdiskurses’ verweist Urmila Goel auf die diesen zugrunde liegenden Konstruktion der abweichenden Anderen, über welche sich die zur Norm erklärten Dominanzgesellschaft erst hervorbringt. Die Differenzierung zwischen uns und den Anderen erfolgt dabei entlang strukturell verankerter rassistischer, (hetero)sexistischer und klassistischer Vorstellungen sowie jene über normgerechte Körperlichkeit. In den Migrationsdebatten wird diese Differenzierung in vermeintlich eindeutig Zugehörige und Nicht-Zugehörige permanent (re)produziert und somit die ungleichen Machtverhältnisse, auf welchen die gesamte (post)koloniale Weltordnung basiert,stabilisiert. Diese so hergestellte Norm und das Andere ist allerdings nicht eindeutig und stabil, welches auf die Interdependenz verschiedener Machtverhältnisse hindeutet. Diese veranschaulicht Urmila Goel an Beispielen der Verwobenheit von Gender und natio-ethno-kultureller Zugehörigkeit, wie sie z. B. in der Kopftuchdebatte auftreten. Sie beendet ihren Artikel, indem sie anhand von drei Beispielen von Grenzüberschreitungen die damit verbundenen Machtungleichheiten, Interdependenzen und Ambivalenzen aufzeigt.
Zusammenfassung:
Urmila Goel stellt in ihrem Artikel theoretische Überlegungen zu ungleichen und interdependenten Machtverhältnissen an, welche sie auf die Europaregionen und ihren Umgang mit Migration anwendet und daran anschließend alternative Denkansätze rund um Migration erarbeitet. Ausgangspunkt ihrer Überlegungen ist die Feststellung, dass durch die Überschreitung von Grenzen in die und innerhalb der nationalstaatlich organisierten EU Konflikte auftreten. Migration erscheint als ein Problem für die EUNationalstaaten, welches es zu regulieren bzw. zu verhindern gilt. Mit Blick auf die aktuellen Debatten über Migration stellt sie allerdings heraus, dass nicht Migration an sich, sondern die Migration von bestimmten Personen als Problem angesehen wird. In der Analyse des nach ökonomischen Kosten-Nutzen folgenden ‚Bereicherungsdiskurses’ und des ‚Integrationsdiskurses’ verweist Urmila Goel auf die diesen zugrunde liegenden Konstruktion der abweichenden Anderen, über welche sich die zur Norm erklärten Dominanzgesellschaft erst hervorbringt. Die Differenzierung zwischen uns und den Anderen erfolgt dabei entlang strukturell verankerter rassistischer, (hetero)sexistischer und klassistischer Vorstellungen sowie jene über normgerechte Körperlichkeit. In den Migrationsdebatten wird diese Differenzierung in vermeintlich eindeutig Zugehörige und Nicht-Zugehörige permanent (re)produziert und somit die ungleichen Machtverhältnisse, auf welchen die gesamte (post)koloniale Weltordnung basiert,stabilisiert. Diese so hergestellte Norm und das Andere ist allerdings nicht eindeutig und stabil, welches auf die Interdependenz verschiedener Machtverhältnisse hindeutet. Diese veranschaulicht Urmila Goel an Beispielen der Verwobenheit von Gender und natio-ethno-kultureller Zugehörigkeit, wie sie z. B. in der Kopftuchdebatte auftreten. Sie beendet ihren Artikel, indem sie anhand von drei Beispielen von Grenzüberschreitungen die damit verbundenen Machtungleichheiten, Interdependenzen und Ambivalenzen aufzeigt.
0 Kommentare in: lesen ... comment ... link
aber worum geht es denen?
urmila, 19:06h
Zum 20jährigen Bestehen schenkt die taz dem LSVD ein wohlwollendes Interview von Martin Reichert mit Jörg Steinert. Zum Ende des Interviews fragt Reichert:
"Kann der LSVD für sich in Anspruch nehmen, eine ganze Community zu repräsentieren?"
und Steinert antwortet:
"Wir setzen uns für die Interessen von Lesben und Schwulen ein, für Gleichstellung. Es gibt bestimmt Menschen, die sich nicht von uns vertreten fühlen – aber worum geht es denen?"
Ja, wo soll frau denn da anfangen, dem Herrn Steinert zu erklären, warum ich mich so gar nicht vom LSVD vertreten fühle? Weil die Homo-Ehe oder die Zulassung homosexueller Soldat_innen in der Bundeswehr für mich nicht besonders anstrebenswerte Ziele sind? (Die Homo-Ehe ist dem Interview zu Folge eine der größten Leistungen des LSVD.) Weil ich keine Lust auf rassistische Äußerungen habe, wie z.B. im Interview, wenn Steinert sagt:
"Es geht um konstruktive Ansprache, wir wollen Menschen mitnehmen, die Homosexualität ablehnen. Deshalb arbeiten wir auch gezielt an Schulen mit einem hohem Anteil türkischsprachiger und arabischer Schüler. Viele dieser Jugendlichen hatten bislang keine Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Weil ich auch klassistische Aussagen problematisch finde, so Steinerts Behauptung:
"Homophobie gibt es überall, sie ist nur ungleich verteilt. Im Theater gibt es sie weniger als im Fußballstadion, sage ich mal …"
Und weil ich ganz offensichtlich zum Feindbild von Steinert und Reichert gehöre. Nicht nur, weil ich den Rassismus des LSVD kritisiere, sondern auch weil ich zu "gewisser Menschen, die sich auf die Queer Theory und Judith Butler beziehen" gehöre und mit so einfacher Identitätspolitik nichts anfangen kann.
Ich will nicht einfach als Lesbe mehr vom Kuchen abbekommen. Ich will, dass der Kuchen anders gebacken und gerechter verteilt wird.
"Kann der LSVD für sich in Anspruch nehmen, eine ganze Community zu repräsentieren?"
und Steinert antwortet:
"Wir setzen uns für die Interessen von Lesben und Schwulen ein, für Gleichstellung. Es gibt bestimmt Menschen, die sich nicht von uns vertreten fühlen – aber worum geht es denen?"
Ja, wo soll frau denn da anfangen, dem Herrn Steinert zu erklären, warum ich mich so gar nicht vom LSVD vertreten fühle? Weil die Homo-Ehe oder die Zulassung homosexueller Soldat_innen in der Bundeswehr für mich nicht besonders anstrebenswerte Ziele sind? (Die Homo-Ehe ist dem Interview zu Folge eine der größten Leistungen des LSVD.) Weil ich keine Lust auf rassistische Äußerungen habe, wie z.B. im Interview, wenn Steinert sagt:
"Es geht um konstruktive Ansprache, wir wollen Menschen mitnehmen, die Homosexualität ablehnen. Deshalb arbeiten wir auch gezielt an Schulen mit einem hohem Anteil türkischsprachiger und arabischer Schüler. Viele dieser Jugendlichen hatten bislang keine Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Weil ich auch klassistische Aussagen problematisch finde, so Steinerts Behauptung:
"Homophobie gibt es überall, sie ist nur ungleich verteilt. Im Theater gibt es sie weniger als im Fußballstadion, sage ich mal …"
Und weil ich ganz offensichtlich zum Feindbild von Steinert und Reichert gehöre. Nicht nur, weil ich den Rassismus des LSVD kritisiere, sondern auch weil ich zu "gewisser Menschen, die sich auf die Queer Theory und Judith Butler beziehen" gehöre und mit so einfacher Identitätspolitik nichts anfangen kann.
Ich will nicht einfach als Lesbe mehr vom Kuchen abbekommen. Ich will, dass der Kuchen anders gebacken und gerechter verteilt wird.
0 Kommentare in: homonationalismus ... comment ... link
... older stories
 Foto: © Anke Illing
Foto: © Anke Illing