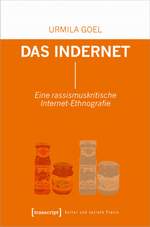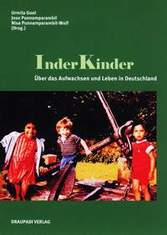... newer stories
Freitag, 25. Oktober 2013
Flüchtlingsunterkunft Köpenick
urmila, 01:36h

Heute abend hatte der Bezirk Treptow-Köpenick zu einer ersten Informationsveranstaltungen für Anwohnende einer neuen Unterkunft für Asylbewerbende in Köpenick eingeladen. Als Mitglied des Integrationsausschusses der BVV Treptow-Köpenick war ich auch bei der Veranstaltung.
Ich hatte den Eindruck, dass die Informationsveranstaltung gut vorbereitet wurde und aktive Netzwerkarbeit in der Umgebung gemacht worden war. Es gab zwar auch Rassismus reproduzierende Fragen (zum Teil wohl auch von überzeugten Rassist_innen, so gab es auch Fragen eines NPD-Vertreters), es kam aber nicht zu einem größeren (offen) rassistischen Konsens. Rassismusreproduktionen wurden auch aus den Reihen der Anwohnenden kritisiert. Es gab viele Hilfsangebote für die erwarteten Asylbewerbenden.
0 Kommentare in: abschieben ... comment ... link
Film: Drama Consult
urmila, 13:42h
Der neue Film Drama Consult von Dorothee Wenner ist gestern im Kino angelaufen. Der Verleih organisiert dabei Podiumsdiskussionen mit der Filmemacherin (mehr Informationen über die Kinotour in 12 Städten). Gestern diskutierte Wenner mit Jahman Anikulapo (Journalist/ Kulturnetzwerker, Schauspieler, Lagos) und Heiko Schwiderowski (Deutscher Industrie- und Handelskammertag).
Eine Diskussion nach dem Film macht durchaus Sinn, denn der Film fordert sein Publikum. Er bricht gleich mehrfach mit Sehgewohnheiten. Die Protagonist_innen sind nigerianische Unternehmer_innen. Sie reisen nach Deutschland, um da Geschäftskontakte anzubahnen. Das produziert nicht die gewohnten Bilder über Nigeria/ Afrika. Und es produziert Bilder über Unternehmer unter sich, die weder in kapitalismuskritische noch neoliberale Bilderwelten ganz passen. Und dann ist da immer die Unsicherheit darüber, was der Dokumentarfilm dokumentiert und was er inszeniert. Denn die Reise ist von der Filmemacherin initiiert.
Kein einfacher Film, aber spannend.
Eine Diskussion nach dem Film macht durchaus Sinn, denn der Film fordert sein Publikum. Er bricht gleich mehrfach mit Sehgewohnheiten. Die Protagonist_innen sind nigerianische Unternehmer_innen. Sie reisen nach Deutschland, um da Geschäftskontakte anzubahnen. Das produziert nicht die gewohnten Bilder über Nigeria/ Afrika. Und es produziert Bilder über Unternehmer unter sich, die weder in kapitalismuskritische noch neoliberale Bilderwelten ganz passen. Und dann ist da immer die Unsicherheit darüber, was der Dokumentarfilm dokumentiert und was er inszeniert. Denn die Reise ist von der Filmemacherin initiiert.
Kein einfacher Film, aber spannend.
1 Kommentar in: Film schauen ... comment ... link
Samstag, 19. Oktober 2013
Tödliche Festung Europa
urmila, 13:31h
Die letzten Wochen haben das tägliche Sterben durch die Abschottungspolitik der EU etwas öffentlicher gemacht. Die Toten vor Lampedusa haben einige Menschen erschüttert (andere weniger). Vor dem Brandenburger Tor durststreiken Menschen ohne menschenwürdiges Aufenthaltsrecht. In Hamburg wurde trotz der momentanen öffentlichen Anteilnahme an den Toten vor Lampedusa eine großangelegte Kontrolle von 'Lampedusa in Hamburg' durchgeführt.
Ein Umdenken in der Politik erscheint unwahrscheinlich. Aber es gibt immerhin kleine Hoffnungsschimmer. Die taz berichtet, dass Polizist_innen Widerstand gegen die Kontrollen versucht haben:
"Örtliche Einsatzleiter hatten gegen den Plan "remonstriert", also rechtliche Bedenken im Rahmen der Verhältnismäßigkeit und Menschlichkeit geltend gemacht. Zudem haben sich nach taz-Informationen mehrere Polizisten vor der Aktion wegen Bauchschmerzen krankgemeldet."
Immerhin.
Ein Umdenken in der Politik erscheint unwahrscheinlich. Aber es gibt immerhin kleine Hoffnungsschimmer. Die taz berichtet, dass Polizist_innen Widerstand gegen die Kontrollen versucht haben:
"Örtliche Einsatzleiter hatten gegen den Plan "remonstriert", also rechtliche Bedenken im Rahmen der Verhältnismäßigkeit und Menschlichkeit geltend gemacht. Zudem haben sich nach taz-Informationen mehrere Polizisten vor der Aktion wegen Bauchschmerzen krankgemeldet."
Immerhin.
0 Kommentare in: abschieben ... comment ... link
Homophobie intersektional
urmila, 13:21h
Anfang der Woche berichteten Medien über Kuwait. Dort soll es Pläne geben, Homosexuelle und Transgender (wenn ich den taz-Bericht richtig interpretiere) die Einreise zu verweigern. Und zwar aufgrund von einem medizinischen Test. Dazu liesse sich viel sagen: über Homophobie bzw. gewaltsam durchgesetzte Heteronormativität, über Konstruktionen von richtigen Körpern und Sexualität, über Pathologisierungen und die Konstruktion von Tests, etc. Der letzte Absatz des taz-Bericht zeigt aber noch etwas anderes:
"Was die kuwaitischen Pläne anbelangt, ist es auffällig, dass sie ausschließlich Arbeitsmigranten betreffen und nicht etwa Touristen. Zweidrittel der Bewohner sind Ausländer, die Tätigkeiten ausüben, die Kuwaitis für unter ihrer Würde halten. Gleichzeitig werden die Arbeitskräfte häufig pauschal als drogenabhängig und kriminell diskriminiert."
Es geht hier also nicht ausschliesslich um Durchsetzung von Heteronormativität sondern ganz klar auch um eine Verschränkung mit sozio-ökonomischer Lage. Es geht um weitere Ausbeutung bereits Ausgebeuteter. Und nicht um westliche schwule Reisende.
"Was die kuwaitischen Pläne anbelangt, ist es auffällig, dass sie ausschließlich Arbeitsmigranten betreffen und nicht etwa Touristen. Zweidrittel der Bewohner sind Ausländer, die Tätigkeiten ausüben, die Kuwaitis für unter ihrer Würde halten. Gleichzeitig werden die Arbeitskräfte häufig pauschal als drogenabhängig und kriminell diskriminiert."
Es geht hier also nicht ausschliesslich um Durchsetzung von Heteronormativität sondern ganz klar auch um eine Verschränkung mit sozio-ökonomischer Lage. Es geht um weitere Ausbeutung bereits Ausgebeuteter. Und nicht um westliche schwule Reisende.
0 Kommentare in: interdependenz ... comment ... link
Donnerstag, 10. Oktober 2013
Einführungskurse
urmila, 00:57h
sind total schön.
Letztes Jahr hatte ich ja hier in Olomouc eine Einführung in kritische Rassismustheorie gegeben und dieses Jahr in Gender Studies. In beiden Fällen haben die Studierenden von dem Fach vorher noch nie etwas gehört, kennen keine Konzepte und Theorien.
Das ist eine ziemliche Herausforderung, weil ich innerhalb von zwei Wochen eine Grundlage legen soll. Das kann nicht viel mehr sein, als dass die Studierenden am Ende wissen, dass es kritische Rassismusforschung bzw. Gender Studies gibt. Dass der theoretische Zugang da ein ganz anderer ist, als in anderen Fächern. Dass das ganze auch mit Fragen von Gerechtigkeit und der Frage davon, wie wir miteinander leben wollen, zu tun hat. Wenn ich das erreiche, bin ich schon zufrieden. Glücklich bin ich, wenn die Studierenden Lust darauf bekommen, sich mehr mit den Themen auseinanderzusetzen.
Es ist spannend, wie die Studierenden auf die ganze andere Weise der Herangehens, auf das In-Frage-Stellen von Normen reagieren. Alle machen den Kurs freiwillig und setzen sich so freiwillig einer ziemlichen Herausforderung aus. Letztes Jahr sind zwei Studierende abgesprungen, dieses Jahr bisher noch keine_r. Das finde ich schon Klasse.
Einigen merke ich an bzw. sie sagen es explizit, dass sie die Fragestellungen der Gender Studies faszinierend und eine Horizonterweiterung finden, auch wenn sie vieles noch nicht verstehen können.
Andere äußern Widerstände ganz offen. Das In-Frage-Stellen von Normen stellt sie offensichtlich in Frage. Sie befürchten, dass Feminist_innen ihnen vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben (nicht auf die Kinder aufpassen, arbeiten müssen, lesbisch werden oder so ähnlich). Trotz ihrer Ängste hören sie aber meinen Ausführungen zu und versuchen dem zu folgen.
Und für mich als Lehrende ist das natürlich auch eine ziemliche Herausforderung. Wie weit kann ich ihnen komplexe Theorien zumuten, wenn alles für sie neu ist. Wann ist es zu viel, wieviel muss es aber sein, um die andere Perspektive aufzuzeigen. Wie gehe ich mit Schwierigkeiten des Verstehens um. Wie reagiere ich auf die Widerstände, ohne diese zu verstärken.
Das ist anstrengend, aber auch sehr befriedigend, weil so direkt ein Ergebnis meiner Arbeit zu sehen ist.
Letztes Jahr hatte ich ja hier in Olomouc eine Einführung in kritische Rassismustheorie gegeben und dieses Jahr in Gender Studies. In beiden Fällen haben die Studierenden von dem Fach vorher noch nie etwas gehört, kennen keine Konzepte und Theorien.
Das ist eine ziemliche Herausforderung, weil ich innerhalb von zwei Wochen eine Grundlage legen soll. Das kann nicht viel mehr sein, als dass die Studierenden am Ende wissen, dass es kritische Rassismusforschung bzw. Gender Studies gibt. Dass der theoretische Zugang da ein ganz anderer ist, als in anderen Fächern. Dass das ganze auch mit Fragen von Gerechtigkeit und der Frage davon, wie wir miteinander leben wollen, zu tun hat. Wenn ich das erreiche, bin ich schon zufrieden. Glücklich bin ich, wenn die Studierenden Lust darauf bekommen, sich mehr mit den Themen auseinanderzusetzen.
Es ist spannend, wie die Studierenden auf die ganze andere Weise der Herangehens, auf das In-Frage-Stellen von Normen reagieren. Alle machen den Kurs freiwillig und setzen sich so freiwillig einer ziemlichen Herausforderung aus. Letztes Jahr sind zwei Studierende abgesprungen, dieses Jahr bisher noch keine_r. Das finde ich schon Klasse.
Einigen merke ich an bzw. sie sagen es explizit, dass sie die Fragestellungen der Gender Studies faszinierend und eine Horizonterweiterung finden, auch wenn sie vieles noch nicht verstehen können.
Andere äußern Widerstände ganz offen. Das In-Frage-Stellen von Normen stellt sie offensichtlich in Frage. Sie befürchten, dass Feminist_innen ihnen vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben (nicht auf die Kinder aufpassen, arbeiten müssen, lesbisch werden oder so ähnlich). Trotz ihrer Ängste hören sie aber meinen Ausführungen zu und versuchen dem zu folgen.
Und für mich als Lehrende ist das natürlich auch eine ziemliche Herausforderung. Wie weit kann ich ihnen komplexe Theorien zumuten, wenn alles für sie neu ist. Wann ist es zu viel, wieviel muss es aber sein, um die andere Perspektive aufzuzeigen. Wie gehe ich mit Schwierigkeiten des Verstehens um. Wie reagiere ich auf die Widerstände, ohne diese zu verstärken.
Das ist anstrengend, aber auch sehr befriedigend, weil so direkt ein Ergebnis meiner Arbeit zu sehen ist.
0 Kommentare in: tschechien ... comment ... link
Dienstag, 8. Oktober 2013
InderKinder auf der Buchmesse
urmila, 21:02h
Buchmesse Frankfurt/ Main, Sonntag, 13.10.13, 14.30–15.30 Uhr, Salon
InderKinder. über das Aufwachsen und Leben in Deutschland (pdf)
Mit: Urmila Goel (Deutschland), Kultur- und Sozialanthropologin;
Herausgeberin von „InderKinder“ (2012)
Harpreet Cholia (Deutschland), Soziologin, Autorin „InderKinder“
Moderation: Martin Gieselmann (Deutschland), Geschäftsführer SAI
Seit der Diskussion um „Computer-Inder“ und die Kampagne „Kinder statt Inder“ wird Migration aus Indien nach Deutschland öffentlich stärker wahrgenommen. Welche Erfahrungen beim Aufwachsen und Leben in Deutschland machen Kinder von indischen Migranten eigentlich? Das Gespräch eröffnet Einblicke in wenig bekannte Migrationsgeschichten, in Prozesse des Anders-Gemacht-Werdens sowie den Umgang mit Zuschreibungen.
InderKinder. über das Aufwachsen und Leben in Deutschland (pdf)
Mit: Urmila Goel (Deutschland), Kultur- und Sozialanthropologin;
Herausgeberin von „InderKinder“ (2012)
Harpreet Cholia (Deutschland), Soziologin, Autorin „InderKinder“
Moderation: Martin Gieselmann (Deutschland), Geschäftsführer SAI
Seit der Diskussion um „Computer-Inder“ und die Kampagne „Kinder statt Inder“ wird Migration aus Indien nach Deutschland öffentlich stärker wahrgenommen. Welche Erfahrungen beim Aufwachsen und Leben in Deutschland machen Kinder von indischen Migranten eigentlich? Das Gespräch eröffnet Einblicke in wenig bekannte Migrationsgeschichten, in Prozesse des Anders-Gemacht-Werdens sowie den Umgang mit Zuschreibungen.
0 Kommentare in: veranstaltung ... comment ... link
Wenig einladend
urmila, 20:55h
Impressionen einer Ausländerin: Mittlerweile sehe ich die Geschäfte und Restaurants hier in Olomouc. Anfangs fand ich es noch schwieriger, auszumachen, wo ich was bekomme. Aber so richtig einladend finde ich sowohl Geschäfte wie Restaurants in der Regel nicht. Es scheint daran zu liegen, dass sie viel weniger, um mich werben, als ich gewohnt bin. Die Restaurants haben häufig keine Speisekarten draussen (die ich allerdings auch kaum lesen könnte). Und sowohl Restaurants wie Geschäfte haben häufig unscheinbare Eingänge, sind im Keller oder einem Gang versteckt. Wenige habe einladende Fronten. Und noch weniger nutzen ein Schaufenster, um mich anzuziehn bzw. mir einen Einblick zu geben. Viele sind zu gestellt oder zugeklebt. Das macht für mich die Hürde reinzugehen um einiges höher.
Nachtrag 17.10.13: Hier nun der Eingang zu einem Laden, in den ich mich erst gegen Ende meines Aufenthaltes getraut habe, und der sehr schöne Lebensmittel hat:

Nachtrag 17.10.13: Hier nun der Eingang zu einem Laden, in den ich mich erst gegen Ende meines Aufenthaltes getraut habe, und der sehr schöne Lebensmittel hat:

0 Kommentare in: tschechien ... comment ... link
Dienstag, 8. Oktober 2013
Umgang mit Geschichte
urmila, 00:27h
Ich gebe gerade eine Einführung in die Gender Studies an der Universität in Olomouc/ Tschechische Republik. Zum Anfang sollten sich die Studierenden zu ein paar (feministischen) Fragen aufstellen, damit ich ein Gefühl für die Gruppe bekomme.
Am Kurs nimmt auch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin teil, die schon über 30 Jahre alt ist. Und das Alter ist durchaus relevant. Denn sie brachte ein, dass sich die Lage der Frauen in der Tschechischen Republik im Verhältnis zur Lage in der CSSR verändert habe, sie sich aber unsicher sei, wie. Die allermeisten in der Gruppe meinten, dass die Frauen heute gleichberechtigter seien, als in der CSSR. Ein interessantes Ergebnis, wenn mensch bedenkt, dass damals die Berufstätigkeit von Frauen wohl mehr gefördert wurde als heute (mit Kinderbetreuung, etc.). (Wenn ich es richtig verstanden habe und nicht einfach nur die DDR-Verhältnisse übertrage.)
Die Mitarbeiterin war auch überrascht, über die Positionierung der jüngeren Studierenden. Sie vermutete, dass jene, die die CSSR nicht mehr erlebt haben, kaum bis keine Kenntnisse über die CSSR haben. In der Schule würde es nicht gelehrt. (Und mein Eindruck ist, dass die CSSR und der Kommunismus grundsätzlich für das Schlechte stehen.) Wenige Jahre Altersunterschied würden so einen massiven Unterschied in der Einschätzung machen.
Am Kurs nimmt auch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin teil, die schon über 30 Jahre alt ist. Und das Alter ist durchaus relevant. Denn sie brachte ein, dass sich die Lage der Frauen in der Tschechischen Republik im Verhältnis zur Lage in der CSSR verändert habe, sie sich aber unsicher sei, wie. Die allermeisten in der Gruppe meinten, dass die Frauen heute gleichberechtigter seien, als in der CSSR. Ein interessantes Ergebnis, wenn mensch bedenkt, dass damals die Berufstätigkeit von Frauen wohl mehr gefördert wurde als heute (mit Kinderbetreuung, etc.). (Wenn ich es richtig verstanden habe und nicht einfach nur die DDR-Verhältnisse übertrage.)
Die Mitarbeiterin war auch überrascht, über die Positionierung der jüngeren Studierenden. Sie vermutete, dass jene, die die CSSR nicht mehr erlebt haben, kaum bis keine Kenntnisse über die CSSR haben. In der Schule würde es nicht gelehrt. (Und mein Eindruck ist, dass die CSSR und der Kommunismus grundsätzlich für das Schlechte stehen.) Wenige Jahre Altersunterschied würden so einen massiven Unterschied in der Einschätzung machen.
0 Kommentare in: tschechien ... comment ... link
Sonntag, 6. Oktober 2013
Sprachkompetenzen
urmila, 14:06h
Meine Reise nach Olomouc (Tschechische Republik) hat mich mal wieder Sprach(in)kompetenzen erleben lassen.
Im überfüllten Zug von Berlin Richtung Budapest war ich noch sprachmächtig. Erstmal zumindest. Als ich anfing mit dem Paar aus Costa Rica zu kommunizieren, musste ich auf Handzeichen ausweichen. Ich kann fast kein Wort Spanisch. Und die Frau schien kein Wort Englisch zu können. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mitteilen konnte, dass wir gerade die Grenze nach Tschechien überquert haben. Der Mann verstand irgendwann meine Versuche Grenze/ border/ frontier so auszusprechen, dass sie mich verstehen können.
Diese Sprachinkompetenz war nicht problematisch für mich, das ich mich auskannte, wusste was passierte und ausprobieren konnte, wie ich mich verständlich machen konnte. So war ich auch in der Lage den Beiden zu erklären, dass sie erst am zweiten Prager Bahnhof aussteigen sollten. Da half mir der Reiseplan, der im Abteil auslag.
Als wir nun aber durch Tschechien fuhren, Menschen mich auf Tschechisch ansprachen und ich mich am Bahnhof mit tschechischen Ansagen auseinandersetzen musste, war ich viel inkompetenter. Nicht ich bestimmte die Kommunikation sondern verstand nicht, was die anderen von mir wollten. Sehr viel unangenehmer.
So unverständlich wie vor einem Jahr ist es allerdings nicht mehr. Auch wenn ich alle Worte, die ich mal in Tschechisch konnte, vergessen habe. Aber ich kann mich besser orientieren, weil ich weiss, worauf ich achten muss, weil ich mich erinnere, wie Dinge gingen. Verstehen ist so viel mehr als Sprachkenntnis.
Im überfüllten Zug von Berlin Richtung Budapest war ich noch sprachmächtig. Erstmal zumindest. Als ich anfing mit dem Paar aus Costa Rica zu kommunizieren, musste ich auf Handzeichen ausweichen. Ich kann fast kein Wort Spanisch. Und die Frau schien kein Wort Englisch zu können. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mitteilen konnte, dass wir gerade die Grenze nach Tschechien überquert haben. Der Mann verstand irgendwann meine Versuche Grenze/ border/ frontier so auszusprechen, dass sie mich verstehen können.
Diese Sprachinkompetenz war nicht problematisch für mich, das ich mich auskannte, wusste was passierte und ausprobieren konnte, wie ich mich verständlich machen konnte. So war ich auch in der Lage den Beiden zu erklären, dass sie erst am zweiten Prager Bahnhof aussteigen sollten. Da half mir der Reiseplan, der im Abteil auslag.
Als wir nun aber durch Tschechien fuhren, Menschen mich auf Tschechisch ansprachen und ich mich am Bahnhof mit tschechischen Ansagen auseinandersetzen musste, war ich viel inkompetenter. Nicht ich bestimmte die Kommunikation sondern verstand nicht, was die anderen von mir wollten. Sehr viel unangenehmer.
So unverständlich wie vor einem Jahr ist es allerdings nicht mehr. Auch wenn ich alle Worte, die ich mal in Tschechisch konnte, vergessen habe. Aber ich kann mich besser orientieren, weil ich weiss, worauf ich achten muss, weil ich mich erinnere, wie Dinge gingen. Verstehen ist so viel mehr als Sprachkenntnis.
0 Kommentare in: tschechien ... comment ... link
Sonntag, 6. Oktober 2013
Graffiti in Olomouc
urmila, 00:08h
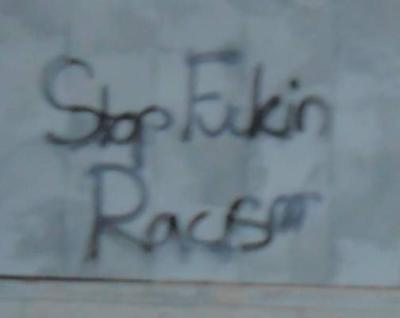
0 Kommentare in: tschechien ... comment ... link
... older stories
 Foto: © Anke Illing
Foto: © Anke Illing